Die Suchthilfe in Deutschland steht vor großen Umbrüchen, und dies nicht nur wegen der Corona-Krise, so dass die Reformen der Suchthilfe in Deutschland bis 2040 entscheidend für deren Qualität in der Zukunft sein werden. Insgesamt kann von einem erheblichen Reformstau – etwa in Bezug auf Modernisierungen der krankenkassen- und rentenversicherungsfinanzierten Therapien – ausgegangen werden. Deshalb werden im Folgenden Entwicklungsaufgaben der Suchthilfe in der Perspektive auf das Jahr 2040 skizziert.
Der Beitrag gibt die Hauptthesen zur Weiterentwicklung der Suchthilfe in Deutschland wieder, die als Hauptvortrag zu den Hamburger Suchttherapietagen 2021 am 11. Mai vorgestellt wurden. Die Erfahrungen und veränderten Bedingungen während der Corona-Pandemie haben besonders klar gezeigt, dass die Suchthilfe sich modernisieren und weiterentwickeln muss. Je nach Blickwinkel ist zu sagen: Sie muss besser werden bzw. sie muss noch besser werden. Ich überlasse Ihnen als Leserinnen und Leser die Entscheidung nach Lektüre meiner Thesen.
Inhaltsübersicht
Sozialhistorische Vorbemerkung
Das deutsche Suchthilfesystem ist im historischen Kontext früh entstanden (ab Ende des 19. Jahrhunderts), hat sich sehr volatil und zyklisch entwickelt (20. Jahrhundert) und weist bis heute neben unleugbaren Vorzügen (gute finanzielle Ausstattung, sehr klare gesetzliche Regelungen in den meisten Bereichen, viele punktuelle Innovationen) leider auch viele Probleme und Defizite auf, vor allem systemisch bedingt. Diese werden im Folgenden dargestellt und exemplarisch mit Lösungswegen skizziert.
Dysfunktionales Beharrungsvermögen
Im Suchthilfesystem ist immer wieder ein schier unhinterfragbares Beharrungsvermögen zu finden, die bei näherer Betrachtung Mythen und empirisch nicht überprüfte Behauptungen sind. Daraus ergibt sich ein Beharrungsvermögen, das sich gegen Subgruppen von Betroffenen richtet, diese ausgrenzt, stigmatisiert und frühzeitigere Zugänge zum Hilfesystem verhindert.
Die zahlreichen Zäsuren in der deutschen Suchthilfe (1919, 1933, 1968, 1989; siehe auch „Entwicklungsaufgaben & Weiterentwicklung der Suchthilfe in Deutschland“) werden durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie durch eine weitere einschneidende Zäsur ergänzt. Die Geschichte des Suchthilfesystems in Deutschland (seit dem Jahr 1879, in dem das erste spezielle „Trinkerasyl“ in Lintorf bei Düsseldorf gegründet wurde) zeigt diese starke Beharrungsvermögen, das systemischen Charakter aufweist. Beispiele dafür sind: Einführung der Psychotherapie, Einzeltherapie für Suchtkranke, Abbau der Stigmatisierung, Rückfallprävention, Substitution, Abstinenzdogma, Komorbiditätstherapie…
Alle diese Veränderungen kamen von außerhalb der deutschen Suchthilfe und wurden gegen teilweise erheblichen Widerstand durchgesetzt. Innovationswillen und Leuchtturmprojekte und -konzepte sind im deutschen Suchthilfesystem erfreulicherweise in großer Zahl vorhanden, aber es mangelt an Implementierung und Verstetigung der wertvollsten Innovationen.
10 Entwicklungsaufgaben der postpandemischen Suchthilfe in Deutschland
1. Abbau der Versäulung und bessere Integration der vorhandenen Suchthilfen
Argument: Das deutsche Suchthilfesystem ist hochselektiv, schließt Klientengruppen aus, erschwert so die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Sektoren, ist also insgesamt zu unflexibel und rigide. Dadurch werden einzelne Klientengruppen mit Bedarf exkludiert und z.T. auch nicht erst erkannt. Grund für die starke Versäulung sind vor allem die gesetzlichen und politischen Vorgaben in den Sozialgesetzbüchern, die im Wesentlichen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so bestehen. Änderungen sind möglich und nötig.
Beispiele und Ziele:
(1) Übergang von ambulanten zu stationären Hilfen und zurück muss flexibler werden (bundesweit!).
(2) Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen barrierefrei und aus einer Hand (Kombi- und Komplexbehandlungen).
(3) Hilfen für Substanz- und Verhaltenssüchtige noch besser integrieren.
(4) Mehr Frühintervention bei zieloffenen Behandlungsstrategien.
(5) Versorgungsnachteile abbauen für definierbare Subgruppen.
Daraus ergeben sich konkret Probleme an den Schnittstellen zwischen verschiedenen Hilfen.
Folgende Schnittstellenprobleme in der Suchthilfe sind typisch:
- Von der Lebenswelt zum Erstkontakt
- Vom Erstkontakt zum Zweitkontakt
- Vom Hausarzt zum Suchtspezialisten
- Von der Suchtberatungsstelle zum Entzug
- Vom Entzug zur Entwöhnung
- Von der Entwöhnung in die Nachsorge und Selbsthilfe.
An jeder dieser Schnittstellen können Klienten den Kontakt verlieren und nicht über die nächste Hürde gelangen.
2. Die transgenerationalen Grenzen müssen durchlässiger werden
Argument: Suchtstörungen verlaufen mit einem hohen transgenerationalen Risiko. Kinder suchtkranker Eltern entwickeln zu ca. 33% (bei alkoholabhängigen Eltern) und zu ca. 55% (bei drogenabhängigen Eltern) eine Suchtstörung. Daher ist die Berücksichtigung des familialen Umfelds relevant. Auch die S3-Leitlinien (Alkohol, Methamphetamin) zeigen bessere Wirksamkeit bei Berücksichtigung des familialen Umfelds und empfehlen daher die Einbeziehung von Partnern und Kinder. Die folgende Abbildung zeigt, dass Kinder suchtkranker Eltern sehr oft auch von anderen psychischen Störungen ihrer Eltern (insbes. Depression, Angst, Persönlichkeitsstörung) betroffen sind.

Beispiele und Ziele:
- Berücksichtigung der Kinder in allen Hilfemaßnahmen von der Beratung, über den Entzug, die Entwöhnung bis zu Suchtselbsthilfe
- Therapie der Eltern sollte routinemäßig die Entscheidung, Prävention oder Therapie der Kinder notwendig ist, umfassen und dann ggf. umsetzen. Hilfen für suchtkranke Eltern in ihrer Elternschaft. Abbau der Individuumsfixierung in den Hilfesystemen
- Die gesetzlichen Regelungen (SGB V, SGB VI, SGB VIII, SGB IX) müssen sich den Suchtkranken und den Angehörigen anpassen und nicht umgekehrt. Die seit über 100 vorherrschende Individuumsfixierung in den Sozialgesetzbüchern muss aufgegeben und stattdessen durch eine systemische, transgenerationale Perspektive substituiert werden.
3. Suchtstoffe und Suchtprobleme müssen in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden
Argument: Suchtstörungen treten sehr häufig komorbid mit anderen Suchtstörungen (interne Komorbidität) oder anderen psychischen Störungen (externe Komorbidität) auf. Dies sollte bei Prävention und in Behandlungsprogrammen von vornherein mitberücksichtigt werden. Die simultane Behandlung von Komorbiditäten muss zum Regelfall, die Nicht-Mitbehandlung um Ausnahmefall werden. Besonders oft werden bei den internen Komorbiditäten Tabakabhängigkeit und einzelne Verhaltenssüchte übersehen bzw. nicht (mit-)behandelt. Die längerfristige Zyklik von Suchterkrankungen über die Lebensspanne muss insgesamt und individuell gesehen und berücksichtigt werden. Dies gehört zum umfassenden, notwendigen Blick auf Suchtkrankheiten.
Beispiele:
- „Reine“ Tabakabhängigkeit sollte vom gesamten Suchthilfesystem an allen „Orten“ behandelt und angegangen werden. Hier besteht die höchste Letalität aller Suchterkrankungen
- Suchtverlagerungen über die Lebensspanne („Zyklik“) hinweg betrachten und in die Behandlungsprogramme einbauen.
- Substanz- und Verhaltenssüchte standardmäßig in integrierten Programmen behandeln
- Early- und Late-Onset Verläufe beachten, insbesondere im Kontext biographischer Verläufe und Lebenskrisen und deren Auswirkungen
- Transdiagnostische Konzepte („Grundstörungen“) auf die Suchttherapie anwenden.
4. Sucht- und Drogenhilfe muss alle Hilfe- und Beratungsthemen abdecken
Argument: Substanzkonsumenten und Suchtkranke haben ein großes Spektrum möglicher Bedürfnisse und hilferelevanter Themen. Von Fragen zu den Substanzwirkungen und –risiken, über psychosoziale und medizinische Anliegen, Überlebens- und Alltagshilfen bis hin zu veränderungsbezogenen Themen. Diese sollten personenzentriert und zieloffen aufgenommen und mit den Klienten bearbeitet werden. Die ambulante Suchtberatung in Deutschland verfügt nach wie vor nicht über ein routinemäßiges Wirksamkeitsmonitoring, was gut 40 Jahre nach dem Aufbau dieses Systems verwunderlich ist (siehe auch „Suchtberatung in Deutschland – Der weite Weg von der Konfession zur Profession“). Lediglich im Bereich der ambulanten Rehabilitation werden regelmäßig Katamnesen und Qualitätsstudien veröffentlicht (siehe „Wie wirksam ist die Suchtrehabilitationsbehandlung? Ergebnisse der Katamnesebefragungen aus verschiedenen Verbänden“).
Beispiele:
- Sucht- und Drogenberatung sollten Ausstiegs-, Reduktions- und Konsumberatung umfassen und nicht einseitig ausstiegs- bzw. abstinenzorientiert arbeiten. Nur so können sie auf umfassende Akzeptanz bei Klienten stoßen.
- Es sollten flächendeckend zieloffene Hilfen und Beratungsangebote vorhanden sein.
- Das (partiell) schlechte Image von Drogenberatungsstellen resultiert auch aus der Engführung auf Abstinenz- bzw. Ausstiegsorientierung.
5. Digitalisierung und Hybridstrukturen müssen weiterentwickelt werden
Argument: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Allgemeinen und der Suchthilfe im Besonderen bietet Chancen und Risiken zugleich. Die Chancen sollten mutig und proaktiv ergriffen, die Risiken minimiert werden. Digitale und hybride Interventionen und Programme in Prävention, Behandlung, Rückfallprophylaxe und Nachsorge bieten Chancen zur Verbesserung der bestehenden Hilfen. Optimierte, vor allem hybride, Interventionen sollten dringend erforscht, evaluiert und implementiert werden.
Beispiele:
- Digitalisierte Suchthilfe ist mehr als Zoom-Konferenzen und Online-Beratung. VR (virtual reality), EMA (ecological momentary assessment), CET (cue exposure therapy) und andere digitalisierte Verfahren müssen in die Suchttherapie (insbes. Rückfallprävention) integriert werden und zu hybriden Hilfestrukturen führen.
- Suchtkranke in benachteiligten ländlichen Regionen sollten durch digitalisierte Hilfen eine verbesserte Versorgung erhalten. Dieser Aspekt kommt bislang in fast allen Bemühungen zur Verbesserung der Versorgung Suchtkranker zu kurz und sollte in postpandemischen Zeiten mit den Chancen hybrider Interventionen endlich gelöst werden.
- Die kurz vor dem Eintritt der Corona-Pandemie verabschiedete „Essener Leitgedanken zur digitalen Transformation in der Suchthilfe“ bilden eine Grundlage zur Koordination der notwendigen Innovationen. Anfang 2021 wurde von Dr. Peter Tossmann und Fabian Leuschner (Berlin) eine Konzeption einer trägerübergreifenden digitalen Beratungsplattform für kommunale Suchtberatungsstellen vorgelegt. Es bleibt zu hoffen, dass die hier beschriebenen digitalen Strategien bald flächendeckend Umsetzung finden.
6. Der Mangel an Suchtforschung und Forschungsstrukturen muss überwunden werden
Die Suchtforschung hat in Deutschland traditionell einen geringen Stellenwert und erfährt keine adäquate öffentliche Ausstattung bzw. Förderung. Dies ist Teil der Abwehrstrategien zur Wahrnehmung des Ausmaßes des realen Suchtproblems in der Gesamtbevölkerung, vor allem in Bezug auf Alkohol, Tabak und verschiedene Verhaltenssüchte. Angesichts der Tatsache, dass Suchtstörungen bei Männern die häufigste psychische Störung darstellen, ist die Forschung zu Suchtentstehung, Suchtprävention und Suchttherapie marginal ausgestattet. Der genaue Umfang der Suchtforschung in Deutschland beläuft sich jährlich auf ca. 40 Mill € (geschätzt). Die beiden US-amerikanischen Forschungsagenturen im Suchtbereich (NIAAA und NIDA) verfügen im Jahr 2021 über ein Budget von 1,93 Mrd $. Dies entspricht etwa dem 50-fachen des deutschen Budgets bei einer vierfach größeren Bevölkerung.
Argument: Suchtforschung ist der Motor für Innovationen und Evidenzgenerierung. Sie sollte im Sinne einer personenzentrierten, individualisierten und systemischen Forschungsdisziplin („addiction science“, wie sie in USA schon lange etabliert ist) massiv ausgebaut und implementiert werden. Nur so kann sie nachhaltig einer evidenzbasierten Gesundheitsversorgung für Suchtgefährdete und Suchtkranken dienen. Es geht dabei um Grundlagen- und Anwendungsforschung, vor allem in den Bereichen Suchtentstehung (Ätiologie), Risiken, Substanzwirkungen, Entwicklungspsychopathologie, Langzeitverläufe, Sucht- und Psychotherapiestudien, Suchthilfesystem- und Versorgungsforschung. Ziel muss es sein, die evidenzgenerierende und –basierte Qualität und besonders Innovationsfähigkeit im Suchthilfesystem durch solide und breit aufgestellte Suchtforschung zu verbessern.
Beispiele:
- Nach wie vor kein nationales Suchtforschungszentrum in Deutschland. Um Verwechselungen vorzubeugen: Die DHS ist ein Zusammenschluss der im Suchtbereich tätigen Wohlfahrtsverbände und der Suchtfachverbände und keine Suchtforschungseinrichtung.
- Immer wieder punktuelle Forschungsförderungen ohne ausreichend Nachhaltigkeit.
- Zu wenige oder keine Lehrstühle in den Bereichen Suchtmedizin, Suchtpsychologie und Suchtsoziologie.
- Bei Innovationen in der Gesundheitsforschung bleibt die Suchtforschung meist außen vor, so auch derzeit fast völlig bei den im Jahr 2021 neu eingerichteten Zentren für psychische Gesundheit.
- Zu wenig oder keine systematische wissenschaftliche Nachwuchsförderung.
- Kaum Suchthilfesystemforschung.
7. Suchtprävention in allen Handlungsfeldern stärken
Die Suchtprävention ist fraglos der Königsweg unter allen Interventionen im Gesundheitsbereich.
Argument: Dieser Königsweg wird viel zu selten beschritten. Dafür sind defizitäre Konzepte, mangelhafte Finanzierung, fehlende oder defizitäre Evaluationen verantwortlich. Evidenzbasierte Suchtprävention ist längst beschrieben und möglich. Viele hervorragende punktuelle Projekte kommen nicht in die Fläche. Es fehlt an Transfer- und Implementierungsstrategien und –verantwortlichkeiten. Ebenso an Qualifikationen, Berufsbild und Forschungsstrukturen.
Beispiele:
- Schon im Jahr 2014 wurde von elf Wissenschaftlern und Praktikern das „Kölner Memorandum zur Evidenzbasierung in der Suchtprävention“ entwickelt. Darin befinden sich zahlreiche Hinweise, wie die Wirksamkeit suchtpräventiver Interventionen besser und vor allem nachhaltig abgesichert werden kann.
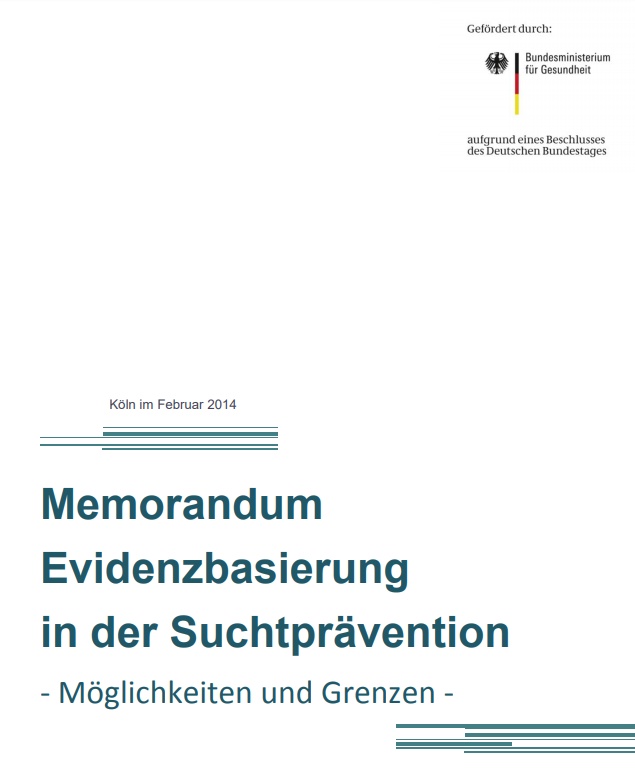
2. Suchtprävention muss evidenzbasiert sein oder neue Evidenzen generieren. Es braucht noch mehr nachhaltige, konzertierte, evidenzbasierte Programme, vor allem in der selektiven und indizierten Suchtprävention und in der verhältnisorientierten Suchtprävention
3. Good-Practise-Beispiele der Suchtprävention: SKOLL, HALT, FRED, ETAPPE, TRAMPOLIN usw.
4. Suchtprävention ist als lebenslanges Lernen zu implementieren: Von pränatal bis Postberentung.
8. Genderreflektierte Suchthilfeangebote stärken
Argument: Es ist schon lange bekannt, dass die Ätiologie von Suchtstörungen enge Zusammenhänge mit Geschlechts- und Gendervariablen aufweist. Männer sind bei den meisten Suchtstörungen drei- bis viermal häufiger betroffen als Frauen. Dem müssen spezielle Ursachen im Bereich der Sozialisationsbedingungen, der Biologie und Psychologie zugrunde liegen (siehe auch „Psychische Störungen bei Männern: Entstehung & Verlauf“). Diese ätiologischen Gründe müssen weiter in geschlechtsspezifischer und –differenzierender Weise beforscht und die Ergebnisse in evidenzbasierte Behandlungsprogramme für die verschiedenen Zielgruppen umgesetzt werden. Gerade in Bezug auf suchtkranke Männer fehlen noch Schwerpunktprogramme für ihre Lebenslagen und –phasen. Es fehlen Leitlinienaussagen zu Männern weitgehend.
Erfreulicherweise machen zwei führende deutschsprachige Suchtfachzeitschriften im Frühjahr 2021 mit dem Thema „Männer und Sucht“ auf. Der Nachholbedarf ist groß.
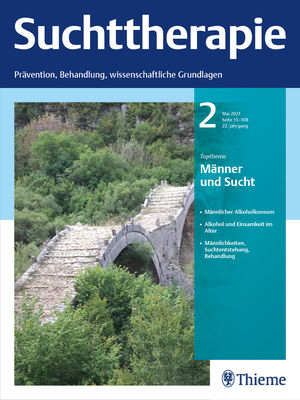

Beispiele:
- Für Männer und Frauen geschlechtsreflektierte Angebote schaffen. Es fehlen nach wie vor besonders spezialisierte Angebote für suchtkranke Männer, obwohl diese die große Mehrheit darstellen (Ausnahme: Das Programm „Männlichkeiten und Sucht“ des LWL, Koordinationsstelle Sucht, Münster)
- Sexuelle Minderheiten berücksichtigen.
- Besonders die große Mehrzahl der Suchtkranken und Suchtgefährdeten (also Männer) spezifisch und empathisch in den Blick nehmen und behandeln.
- Auch mehr genderreflektierte Suchtpräventionsangebote, insbesondere für Jungen, schaffen! (z.B. wg. Boy Crisis). Der weltbekannte Psychologe Philip Zimbardo engagiert sich seit Jahren für dieses Thema.
9. Qualifikation der Fachkräfte sichern und ausbauen
Argument: Die Qualifikation der Fachkräfte im Suchtbereich sollte frühzeitig (im Studium) beginnen. Eine spezialisierte Weiterbildung in einem von mehreren Vertiefungsbereichen baut dann darauf auf. Suchtforschung wie auch Suchthilfepraxis sind relevante Bereiche, die auch miteinander verbunden sein sollten. Nach Abschluss einer suchtspezifischen Qualifikation (Psychotherapie, Psychiatrie, Suchttherapie) erfolgt eine kontinuierliche Weiterbildung. Diese sollte auch interdisziplinäre Elemente umfassen. Die Realität in Deutschland sieht jedoch völlig anders aus. In den grundständigen Studiengängen der Medizin, Psychologie und Sozialen Arbeit taucht das Thema „Sucht“ höchst selten und auch unsystematisch an einzelnen Hochschulen auf anderen aber nicht. In allen für die Suchthilfe relevanten Berufszweigen herrscht ein Nachwuchsfachkräftemangel.
Beispiele:
- Mehr suchtspezifisches Wissen in den grundständigen Studiengängen (Medizin, Psychologie, Soziale Arbeit, Pflege, Gesundheitswissenschaften, Pädagogik) durch obligatorische Verankerung in den Curricula.
- Suchtspezifische Curricula auf Master-Ebene für Prävention, Beratung und Therapie verankern. In den Facharzt-Ausbildungen (Psychiatrie, Internistik, Allgemeinmedizin) mehr suchtspezifische Inhalte obligatorisch machen.
- Weiterbildungen („life-long-learning“), insbesondere für Suchttherapeuten, obligatorisch machen.
- Eine neuerlich hinzugekommene, erschwerende Problematik für die Sicherung der suchttherapeutischen Fachkräfte, ist die seit Februar 2021 präzisierte Vorstellung der DRV-Bund, dass die in den anerkannten Weiterbildungscurricula befindlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der gesamten Weiterbildungszeit in einer von der DRV anerkannten Einrichtung der medizinischen Suchtrehabilitation tätig sein müssen. Diese Regelung ist berufs- und praxisfremd und kontraproduktiv, da sie den Erwerb einer breiten Berufserfahrung im Bereich der gesamten Suchthilfe verhindert. Außerdem werden die ambulanten und stationären Suchtrehabilitationseinrichtungen ungefragt zu Ausbildungseinrichtungen, ohne dass dies jemals mit ihnen konsentiert worden wäre. Insgesamt droht durch diese Engführung in der Qualifikation des beruflich-therapeutischen Nachwuchses ein noch stärkerer Fachkräftemangel in der Zukunft.
10. Suchtspezifisches Knowhow in die Drogenpolitik einbringen
Argument: Die deutsche Drogenpolitik befindet sich seit Jahren in einer Veränderungsstarre. Internationale Entwicklungen werden ignoriert. Selbst kleinere Reformen scheinen unmöglich. Bevor nach jahrelangem Stillstand in der Zukunft möglicherweise überstürzte Reformen implementiert werden, sollten internationale Erfahrungen (z.B. aus Kanada, Portugal, Norwegen, Schweiz) dokumentiert und evaluiert werden. Dabei ist die fachliche Kompetenz der internationalen und deutschen Suchtfachkräfte, der Betroffenen und Angehörigen einzubeziehen. Die Situation der deutschen Drogenpolitik entspricht einem Reformvakuum, bei dem aus wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren Gründen Starre und Beharrung herrschen (siehe auch „Deutsche Drogenpolitik im Dornröschenschlaf? (…)“).
Beispiele und Ziele:
- Die vielfältigen anstehenden drogenpolitischen Reformen und Neuregelungen sollten endlich auf der Basis soliden Fachwissens getroffen werden. Dafür sollte eine nationale Expertenkommission unter Beteiligung von Suchtforschern und Suchthilfepraktikern einberufen werden. Diese begleitet die anstehenden Reformen. Ähnliche Vorgehensweisen wurden in anderen Ländern (z.B. UK) bereits erfolgreich praktiziert.
- Die wissenschaftlichen und praktischen Kompetenzen der Suchthilfe sollten über Verbände und Fachgruppen, aber auch Ad-Hoc-Expertengruppen in die Politik einfließen, damit möglichst evidenzbasierte oder evidenzgenerierende Reformen geschehen.
- Drogenpolitische Reformen sollten routinemäßig von der Suchtforschung begleitet und evaluiert werden. Drogen- und Suchtpolitik sollten rationalen und evidenzbasierten internationalen Leitlinien folgen.
Fazit
Die skizzierten postpandemischen Entwicklungsaufgaben der Suchthilfe in Deutschland stellen ein umfangreiches Reformpaket dar. Die Corona-Pandemie ab 2020 ist ein einschneidendes Ereignis gewesen, was den Reformdruck noch einmal deutlich erhöht hat. Als Leitgedanke für die anstehenden Aufgaben kann gelten: Das deutsche Suchthilfesystem kann noch besser werden und sollte es auch… auf der Basis vieler guter Traditionen, Ansätze und Leuchttürme, zu wenig institutionalisierter Innovationen, zu wenig etablierter Forschung und Evidenzgenerierung, zu geringer Finanzierungsgrundlagen in manchen Bereichen und vieler postpandemischer Chancen.
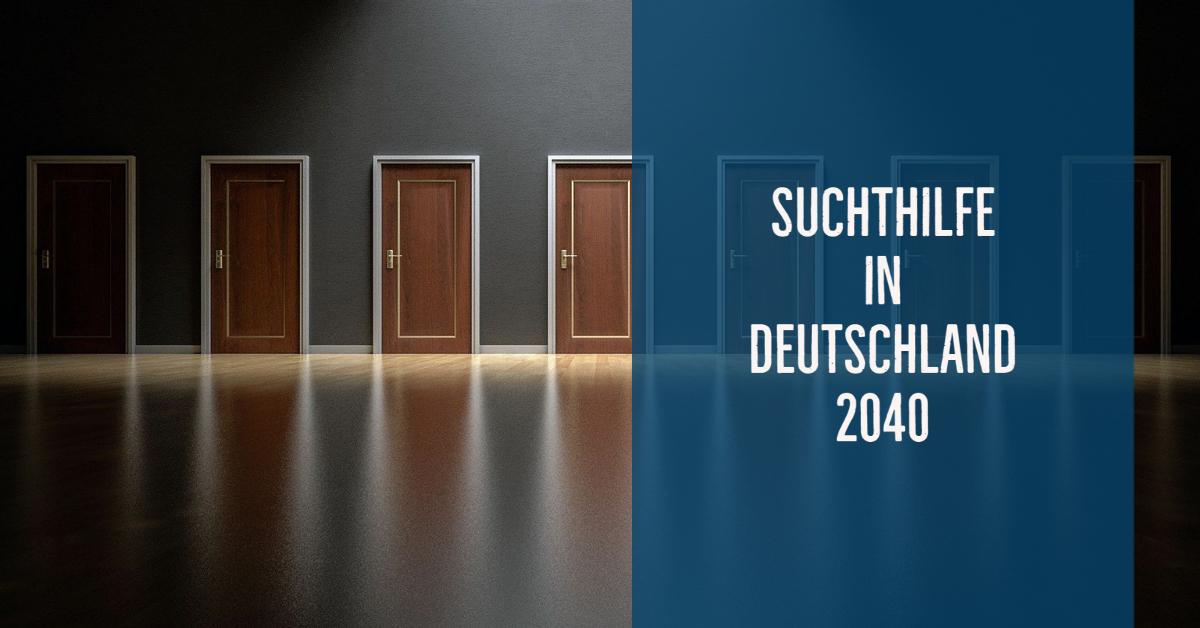
One thought on “Suchthilfe in Deutschland 2040: Prävention, Beratung und Behandlung unter sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen”