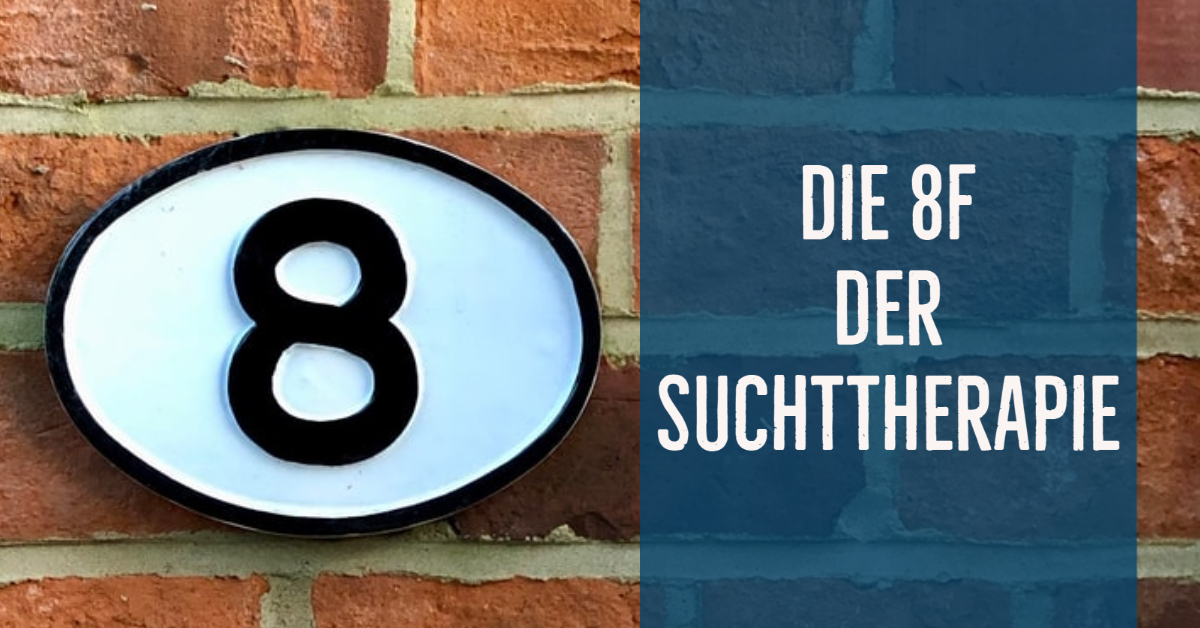Inhaltsübersicht
Die besondere Geschichte der Suchttherapie in Deutschland
Suchttherapie gilt als schwierig, aufreibend und wenig erfolgreich. Bei genauerer Analyse der vorliegenden Evidenz stellt sich dies als ein Mythos heraus. Die Effektivität lässt sich im Vergleich mit anderen chronischen Erkrankungen durchaus sehen. Im Bereich der Alkoholabhängigkeit erreichen bis zu 60% der stationär in Entwöhnungskliniken behandelten Patienten ein Jahr nach Behandlungsende das Zielkriterium (abstinent oder dauerhaft abstinent nach Rückfall).
Die Suchttherapie stellt dabei in Deutschland einen Sonderversorgungsbereich zwischen Psychiatrie, Sozialtherapie, Psychotherapie und Sozialarbeit dar. Von allem etwas, aber auch zwischen allen Stühlen. Dies liegt an der Kultur- und Sozialgeschichte der Suchttherapie. Sie wurde ab 1880 forciert aufgebaut, um den grassierenden proletarischen Alkoholismus in sogenannten Trinkerheilstätten zu bekämpfen. Die Gründung der Invalidenversicherung im streng feudal-kapitalistischen deutschen Kaiserreich im Jahre 1891 (heute: Rentenversicherung) als Leistungsträger dieser Maßnahme unterstreicht dies. Im Fokus stand und steht noch heute die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit des Suchtkranken. Dadurch hat sich, seitdem Sucht als psychische Krankheit anerkannt ist und sich psychotherapeutische Suchtbehandlungen entwickelt haben, ein Spannungsfeld zwischen Krankenbehandlung und Rehabilitationsbehandlung ergeben, das es so nur in Deutschland gibt. Hinzu kommen seit den 1970-er Jahren drogentherapeutische Einrichtungen, die unter den besonderen Bedingungen der Strafverfolgung psychisch kranker Mensch wegen Besitz und Handel von Drogen arbeiten.
Suchtbehandlung ist als Disziplinierungsinstrument der schnapstrinkenden Arbeiterschaft entstanden. Von den Folgen dieses Ursprungs – mag man es nun Erbsünde oder Geburtsfehler nennen – muss sie sich noch final befreien.
Einstieg in die Suchttherapie
Besonders der Einstieg in die Suchttherapie gestaltet sich schwierig. Viele Suchtkranke, vor allem Alkoholabhängige, werden nicht oder viel zu spät vom Hilfesystem erreicht. Die meisten Abhängigen sehen die Notwendigkeit des Ausstiegs aus dem Konsum nicht ein, haben keine Motivation zur Abstinenz und beginnen eine Therapie – wenn überhaupt – nur unter äußerem Druck. Wie es dazu kommt, dass am Anfang der meisten Suchttherapien und persönlichen Veränderungswege von Suchtkranken Wahrnehmungsfehler und Abwehrmechanismen vorliegen, ist in dem Beitrag „Sucht als Wahrnehmungs- und Denkstörung: Kognitive Abwehr und Verzerrungen bei Suchtstörungen“ beschrieben.
In diesem Beitrag geht es nunmehr um die konkreten Wege in eine – oft gesundheits- oder gar lebensrettende – Therapie. Wie kann dies gelingen – ohne Zwang, aber mit klarer Richtungsweisung und Steuerung, wenn der Betroffene gar nicht erkennt oder erkennen will, dass er süchtig ist und eine Änderung dringend nötig ist? Am Anfang eines Veränderungsprozesses bei Suchtstörungen sind Interventionen wichtig, die den Betroffenen nachdenklich und zweiflerisch machen, ob er sein bisheriges Verhalten so weiterführen sollte. Meistens vorhandene innere Zweifel, die durch Schamgefühle nach außen abgeschirmt sind, sollen verstärkt und differenziert werden. Um den Kreislauf, den das Suchtverhalten darstellt, zu durchbrechen, bedarf es einer Unterbrechung der sich in immer wiederkehrenden Schleifen wiederholenden Abläufe aus Verlangen – Beschaffung – Konsum – Konsumwirkung – Wirkungsende – neues Verlangen.
Suchtkranke können diese Kreisläufe, die in der Psychoedukation als „Teufelskreise der Sucht“ bezeichnet werden, meistens selbst nicht durchbrechen.
Einstieg in Veränderung – durch Krisen
Der Einstieg in die Veränderung des Suchtverhaltens geschieht nach allgemeiner praktischer Erfahrung und den Reflektionen Ex-Süchtiger regelhaft in Krisensituationen und durch äußeren Druck. Dies wird als Fremdmotivation verstanden und bietet ein adäquates Verständnis eines gelingenden Veränderungsprozesses. Dies hatte auch schon Professor William Miller erkannt, als er 1985 mit seinem britischen Kollegen Stephen Rollnick den seinerzeit neuen Ansatz einer motivierenden Therapie (Motivational Interviewing) für Suchtkranke entwickelte. Bei den krisenhaften Phasen, die eine Chance auf Verhaltensänderung eröffnen, handelt es sich um physische, psychische oder soziale Krisen. Physische Krisen ergeben sich durch körperliche Erkrankungen oder akute Zusammenbrüche, z.B. durch Drogenvergiftung, Überdosierung oder starke Entzugszustände. Psychische Krisen können in Zusammenhang mit Leistungsversagen, Depressivität, Parasuizidalität oder Einsamkeit auftreten. Diese hängen oft mit sozialen Krisen, etwa nach Trennung, Arbeitsplatzverlust oder strafrechtlicher Verfolgung, zusammen. Die auftretenden Krisen sollten zeitnah motivational zur Anbahnung einer Behandlung genutzt werden.
Veränderungsbereitschaft durchläuft Phasen – das Transtheoretische Modell
Zentral für motivationale Prozesse zur Erhöhung der Veränderungsbereitschaft ist die Vorstellung, dass Suchtkranke eine längere Phase der Ambivalenz durchmachen, bevor sie zur Veränderung ihres Verhaltens und der auslösenden Gründe bereit sind. Vor dieser auch als Besinnungsphase („contemplation“) bezeichneten Stufe liegt die Phase der Vorbesinnung („precontemplation“). Hier hat der Betroffene kein (bewusstes) Wissen von seinem Problem, sehr wohl aber das Umfeld: Partner, Kinder, Eltern, Kollegen usw.
Wichtig in dieser Phase ist es, durch gezielte Rückmeldungen ohne Verachtung und Verurteilung den Betroffenen zu einem verstärkten Nachdenken über sich selbst zu bringen, damit er sich realistischer sehen kann. Die Fähigkeit, sich „mit anderen Augen“ – wie von außen – und später mit einem differenzierteren Blick von innen zu betrachten, soll in dieser Phase gefördert werden, um Veränderungsmotivation zu wecken und zu fördern. Kommt der Betroffene dann in die Besinnungsphase, wird der weitere Prozess auf der Ambivalenz zwischen „ich will so bleiben“ und „ich muss mich verändern“ aufgebaut.
Die Wahrnehmung der negativen Konsequenzen der Sucht triggert die Veränderungsbereitschaft
In der Besinnungsphase, in der eine stabile Veränderungsmotivation entstehen soll, spielen die langfristigen negativen Konsequenzen des Substanzkonsums eine wichtige Rolle. Diese sollen differenziert wahrgenommen, emotional erlebt und entsprechend bewertet werden. Das Ziel dieses psychologischen Prozesses ist eine realistischere und tiefere Selbstbetrachtung, um die meist etablierten gewohnheitsmäßigen Abwehrprozesse aufzulösen. Auf die Besinnungsphase folgen die Phasen: Entscheidung zur Veränderung, Veränderungshandlungen, Stabilisierung der Veränderungen, Rückfall in altes Verhalten, neuerliche Besinnungsphase usw.
Wieso sich verändern?
Im Kern ist menschliche Veränderung immer noch ein Geheimnis. Aber vieles wird inzwischen schon besser verstanden als früher, auch durch die suchtspezifischen Forschungen (siehe auch: Gesellschaft unter Veränderungszwang – Von der Schwierigkeit, alte Gewohnheiten loszuwerden). Eine Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderung ergibt sich am häufigsten durch erlebten Leidensdruck und erlittene Nachteile. Eine in die Zukunft vorauseilende Kognition, also eine Antizipation, dass eine Änderung bei Fortführung des alten Verhaltens nötig sein wird, ist seltener. Viel wirksamer ist die Fokussierung der Wahrnehmung auf die längerfristig negativen Konsequenzen des eigenen Verhaltens. Diese sollten im Sinne einer intensiven Problemwahrnehmung als die Folgen des eigenen Verhaltens erlebbar und spürbar sein, damit die Motivation für Verhaltensänderung wächst und es schließlich zur Einsicht in ihre Notwendigkeit, aber auch Möglichkeit kommt. Bei genauerer Betrachtung und Analyse der Folgen chronischen Suchtverhaltens kristallisieren sich acht Bereiche heraus, die im Folgenden als die 8F der Sucht bezeichnet werden.
Was alles zur Veränderungsmotivation führt
Die 8F der Veränderung bei Sucht beziehen sich auf die negativen Konsequenzen süchtigen Verhaltens. Diese sind: (1) Familie, (2) Firma, (3) Fitness, (4) Finanzen, (5) Freiheit, (6) Führerschein, (7) Freunde und (8) Freizeit. Das motivationspsychologische Modell der 8F der initialen Fremdmotivation in der Suchttherapie wird im Folgenden näher beschrieben:
(1) Familie
Familienmitglieder leiden unter der Sucht ihres Angehörigen besonders intensiv und lange. Täglich sind sie nahe am Geschehen und erleben viele problematische Verhaltensweisen des Suchtkranken von Unberechenbarkeit, Instabilität, Unzuverlässigkeit bis hin zu verbaler und physischer Gewalt. Ihr Leben ist durch hohen Alltagsstress belastet. Viele Familienangehörige erleiden ein hohes Ausmaß an psychologischem Alltagsstress, der sie auf Dauer krankmachen kann. Dies gilt auch für die exponierten Kinder. Wenn die Familienangehörigen leiden und es zu Konsequenzen kommt, kann und soll dies auch den Suchtkranken (be-) treffen. Wenn ein von der elterlichen Sucht exponiertes Kind in der Schule verhaltensauffällig wird und der Vater beim Elterngespräch seine Rolle in Bezug auf die Problementwicklung bei seinem Kind erkennt, ist dies eine wichtige Weichenstellung in Richtung „Therapie der Sucht“. Aber auch durch Interventionen seitens des Jugendamtes wegen Kindeswohlgefährdung infolge der Suchterkrankung eines Elternteils können wichtige Veränderungsimpulse ausgehen.
(2) Arbeit
Die Arbeitswelt hat für moderne Menschen einen hohen Stellenwert, zum einen für die Absicherung des Lebensunterhaltes und die Schaffung von Wohlstand, zum anderen als Quelle von Selbstwert und sozialer Bestätigung. Eine Suchtkrankheit wirkt sich auf kurz oder lang negativ auf Arbeitsleistung und Zuverlässigkeit aus, auch wenn der Suchtkranke selbst dies oft nicht wahrhaben will. Will der Arbeitgeber einem suchtkranken Mitarbeiter helfen, sollte er ihn im Rahmen eines Stufenplans („Eskalationsleiter“) zur notwendigen Verhaltensänderung motivieren. Am Anfang stehen auf der einen Seite Feedbackgespräch, Ermahnung, Abmahnung und Kündigungsandrohung, während auf der anderen Seite Hilfen in Form von Selbsthilfemanual, Beratung, Therapie (ambulant oder stationär) und Suchtselbsthilfegruppe angeboten werden. Die Maßnahmen und Hilfen sollten konsekutiv aufeinander abgestimmt sein. Am besten ist die Handlungsstrategie in ein Gesamtkonzept eines betrieblichen Gesundheitsmanagements eingebunden.
(3) Fitness
Fitness steht für körperliche und mentale Gesundheit. Chronischer Substanzkonsum und insbesondere süchtiger Konsum (dauerhaft und/ oder exzessiv) schädigt Körper und Geist. Alkohol und Tabak als die am häufigsten missbrauchten Substanzen sind im Bereich der körperlichen Gesundheit besonders riskant. Beide Substanzen erhöhen bei chronischem Missbrauch das Risiko für Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie viele weitere Leiden. Im psychischen Bereich kann es bei Alkoholabhängigkeit zum amnestischen Syndrom kommen, bei dem demenzähnliche Zustände auftreten. Für Alkohol- und Nikotinabhängige ergibt sich eine Lebenszeitverkürzung von ca. 10-12 Jahren.
Um die gesundheitlichen Folgen der Sucht deutlich zu machen und beim Suchtkranken Veränderungs- und Behandlungsmotivation zu erzeugen, kommt dem Hausarztsystem eine zentrale Rolle zu. Mehr als 75% aller Suchtkranken haben jährlich mindestens einen Kontakt bei ihrem Hausarzt. Dieser sollte zum Feedback bezüglich des körperlichen Zustands (z.B. Lungenfunktion, Herz-Kreislauf-Schädigungen, Lebererkrankungen usw.) genutzt werden. Wichtig hierbei ist eine akzeptierende und motivierende Gesprächsführung, die Feedback, Psychoedukation und Motivierung miteinander verknüpft. Das „Motivational Interviewing“ und die ärztliche Kurzintervention bietet dem Hausarzt wichtige Interventionsgrundlagen.
(4) Finanzen
Geld ist eine wichtige Ressource zur Lebensgestaltung und für Lebensqualität. Suchtkrankheiten können erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen. Dies betrifft besonders die Suchtformen, bei denen Geld direkt als Finanzierungsmittel der Sucht mit involviert ist und es zu hoher Verschuldung kommt. Insbesondere sind dies Glücksspielsucht und Kaufsucht. Die entstehenden Verschuldungen können als Anlass für eine Verhaltensänderung und für den Beginn einer Therapie genutzt werden. Diese Motivierung kann in Kombination mit der Familie, der Arbeitswelt oder dem Strafrechtssystem entstehen. Dies bedeutet, dass z.B. eine Partnerin ihre Finanzmittel von denen des glücksspielsüchtigen Partners trennt oder auf die Plünderung des Sparbuchs des Kindes durch den Glücksspielsüchtigen mit Aufforderung nach sofortiger Therapie reagiert. Aber auch nach einer Gehaltspfändung aufgrund übermäßiger Verschuldung sollte der Arbeitgeber motivierend gegenüber dem Arbeitnehmer reagieren. Und schließlich können Strafgerichte bei Betrugs- und Unterschlagungsdelikten dem Süchtigen eine Therapieauflage machen.
(5) Freiheit
Bei vielen suchtbedingten Verhaltensweisen kommt es zu strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen (Delikten). Nicht immer werden diese erkannt oder in ihren Ursachen gewürdigt. Insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität (häusliche Gewalt und Gewalt im öffentlichen Raum) kommt es unter chronischem Alkoholmissbrauch zu vielen Delikten. Mehr als ein Viertel aller schweren Körperverletzungs- und Totschlagsdelikte geschehen unter Alkoholeinfluss. Dies heißt natürlich nicht, dass alle alkoholisierten Täter zum Tatzeitpunkt alkoholabhängig waren. Bei Glücksspielsucht und Kaufsucht kommt es verstärkt zu Betrugs- und Unterschlagungsdelikten. Und im Bereich der Abhängigkeit von illegalisierten Drogen kumulieren sich verständlicherweise die BtmG-Delikte: Dies ist eine artifizielle Form der Kriminalität, weil BtmG-Delikte zwangsläufig beim Krankheitsbild der Drogenabhängigkeit auftreten müssen, weil ein straffreier Zugang zu den Substanzen (außer bei der Heroin-Substitution und bei der medizinischen Cannabisverordnung) nicht möglich ist.
Im Falle einer strafrechtlichen Anklage kann das Urteil aus einer Therapieauflage bestehen, mit einer solchen versehen werden oder die Strafe zugunsten einer Suchttherapie ausgesetzt werden. Die entsprechenden Bestimmungen finden sich im StGB und im BtmG. Der drohende Freiheitsentzug kann sich als motivierender Stimulus in Richtung einer Suchttherapie auswirken. Dieser sollte genutzt werden, auch wenn es sich initial um eine Fremdmotivation handelt.
(6) Führerschein
Die Fahrerlaubnis (Auto, Motorrad, LKW) ist für viele Menschen beruflich unverzichtbar. Aber Fahrzeuge sind oft auch Statussymbol, insbesondere für Männer. Verlieren Suchtkranke ihren Führerschein – zunehmend auch wegen Drogenintoxikation – beginnt der Versuch, ihn wieder zurückzuerlangen. Der Weg führt dann über eine MPU (Medizinisch-Psychologische-Untersuchung) als Vorbereitung auf die Eignungsprüfung. Ab 1.1 Promille BAK erfolgt routinemäßig eine Aufforderung zur MPU. Diese wird dann von einem fachkundigen Gutachter durchgeführt. Meist wird angeraten, an einem MPU-Vorbereitungskurs teilzunehmen, da die Fragen der MPU tief in die eigene Persönlichkeit und damit zusammenhängende Probleme – wie vor allem eine Suchterkrankung – führen.
Es ist dabei nicht zweckmäßig, Antworten auswendig zu lernen. Gutachter wollen sehen, dass der auffällig gewordene Fahrer sein Fehlverhalten wirklich verstanden und reflektiert hat und sein Verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich ändern wird. Etwa 90.000 Personen unterziehen sich jährlich einer solchen MPU, davon ca. 60% mit erfolgreichem Ausgang. Beim Verdacht auf ein Alkohol- oder Drogenproblem erfolgen oft starke Beratungs- und Therapieempfehlungen. Der Weg in eine Suchtbehandlung kann dann über die Fremdmotivation, die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen, führen.
Das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) hat ein Informationsblatt zur MPU herausgegeben.
(7) Freunde
Bei Suchtkranken verändern und verengen sich die sozialen Netzwerke stark. Waren anfangs vielleicht noch nicht konsumierende Freunde vorhanden, so verändert sich dies immer mehr. Erfolglose Gespräche mit dem suchtkranken Freund und fruchtlose Ermahnungen führen zu Frustration und Rückzug. Auch kann es zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen, welche in Zerwürfnisse münden. Der Freundeskreis verengt sich immer mehr, es kommt zu vielen Kontaktabbrüchen und das Leben fokussiert sich schließlich ganz auf ebenfalls Konsumierende. Bei Drogenabhängigen konzentrieren sich durch die subkulturellen Regeln des illegalisierten Drogenmarktes die sozialen Bezüge sehr schnell auf ebenfalls Konsumierende. Dadurch kommen weniger Impulse zum Konsumstopp, da die Mitkonsumierenden dafür keinen Anlass haben. Beim Ausstieg aus der Sucht spielen Freunde daher oft keine große Rolle, wohl aber beim Aufbau neuer Sozialbezüge (z.B. innerhalb von Suchtselbsthilfegruppen), die dann die erreichte Abstinenz fördern und stabilisieren sollen.
(8) Freizeit
Sinnvolle und befriedigende Freizeitbeschäftigung ist ein wichtiger Bestandteil eines gelingenden Lebens. Freizeit dient zur Rekreation und Steigerung des Wohlbefindens. Außerdem können Freizeitbeschäftigungen den Selbstwert und die soziale Integration erhöhen. Langfristig suchtkrank zu sein zerstört den Umgang mit Freizeit, die dann nur noch mit Beschaffung und Konsum verbracht wird. Sinnvolle Freizeitbeschäftigungen muss jeder Betroffene für sich selbst entdecken, da sie seinen Neigungen und Interessen entsprechen müssen. Der oft von Suchtkranken berichtete Sinnverlust ist auch eine Folge der psychisch gesunden Wirkungen eines aktiven Freizeitlebens.
So gilt es aus dem Zusammenbruch der Lebensbalance motivationale Energien für eine Veränderung des Verhaltens zu gewinnen. In Suchttherapien werden meist große Energien in den Aufbau neuen, befriedigenden Freizeitverhaltens investiert. Dies kann sich auf Sport, Hobbies, Naturerleben, künstlerisches, musisches oder kreatives Schaffen, soziale Aktivitäten, Spiritualität und Aktivitäten mit der Familie beziehen. Auch passiv-konsumierende Freizeitbeschäftigungen (z.B. Medienkonsum) kommen anfangs in Frage, solange sie vom Substanzkonsum abhalten. Dabei sollte jedoch auf Begrenzung geachtet werden, damit sich nicht eine Suchtverlagerung ergibt. Ein nach einer Suchterkrankung wieder gelingendes Leben kann ein motivationaler Anreiz sein. Betroffene Personen können dabei entweder an frühere Erfahrungen anknüpfen oder neue Kompetenzen aufbauen, um damit spannende, bislang unbekannte Erfahrungen zu machen.
Veränderung beginnt mit F
Die notwendigen und hilfreichen Veränderungen bei schwerwiegenden Lebensproblemen und Krankheiten, wie Suchtprobleme dies darstellen, beginnen in der Regel mit Leidensdruck, negativen Konsequenzen auf körperlicher, sozialer oder psychischer Ebene. Diese spürbar und erlebbar zu machen, ist bei Sucht besonders schwierig, da durch die chronische Intoxikation (Sedierung) und eine sehr repressive Persönlichkeitsstruktur (verdrängen, verzerren, verharmlosen, verschieben) die notwendigen Wahrnehmungen und emotionalen Konsequenzen vermieden werden. Die besondere Abwehrstruktur bei Suchtstörungen wurde bereits hier erläutert.
Bei einer vorliegenden Suchtstörung gilt es nun, den Weg in Veränderung und Hilfe trotz der dominierenden Abwehr zu bahnen. Hierfür ist die koordinierte Nutzung der 8F besonders hilfreich. Fazit: Die Veränderung der Sucht beginnt mit F. Angehörige, medizinische und psychosoziale Fachdienste können die Feränderung unter Nutzung der dargelegten Zugangswege nutzen, wobei die Beziehung zum Suchtkranken respektvoll und akzeptierend in Bezug auf die Person sein sollte.