Inhaltsübersicht
Zusammenfassung
Sucht ist die häufigste psychische Störung bei Männern. Etwa drei Viertel der Alkohol- und Drogenabhängigen sind Männer. Deshalb sind geschlechtsspezifische Ursachenforschung, Prävention und Behandlung von größter Wichtigkeit. Acht zentrale Ursachen sind zu benennen: (1) biologisch Risiken, (2) Rollenstereotype, (3) externalisierende und impulsive Persönlichkeitsfaktoren, (4) peer-Druck, (5) Angst, Depression und Selbstwertprobleme, (6) Stressreduktion, (7) Einsamkeitsprobleme und (8) Abhängigkeits-Autonomiekonflikt. In Bezug auf Prävention und Therapie wird ein stets um eine jungen- und männerspezifische Perspektive erweitertes Vorgehen empfohlen und mit Beispielen erläutert. Dazu zählen im deutschen Sprachbereich vor allem Programme wie „Männlichkeiten und Sucht“ des LWL (Münster) oder „VIKTOR – Hilfen für ältere alkoholabhängige Männer“ des DISuP (Köln).
Summary
Addiction is the most common mental disorder in men. About three quarters of alcohol and drug addicts are men. Therefore, gender-specific causal research, prevention and treatment are of the utmost importance. Eight central causes can be named: (1) biological risks, (2) role stereotypes, (3) externalizing and impulsive personality factors, (4) peer pressure, (5) anxiety, depression and self-esteem problems, (6) stress reduction, (7) loneliness issues and, (8) dependency-autonomy conflict. With regard to prevention and therapy, a procedure that is always expanded to include a boy- and man-specific perspective is recommended. Practice examples are programs such as “Masculinities and Addiction” or “VIKTOR – Help for Older Alcohol-Dependent Men”.
I. Einleitung
Sucht ist die häufigste psychische Störung bei Männern. Dies gilt besonders für Alkoholabhängigkeit, aber auch für drogenbezogene Störungen und Glücksspielsucht. Kann es also sein, dass Männer eine besondere Affinität für süchtiges Verhalten aufweisen, so dass zusammenkommt, was biopsychosozial zusammengehört? Dem wird im Folgenden in Bezug auf die häufigste aller Suchtstörungen, die Alkoholabhängigkeit, nachgegangen. Welche Risikofaktoren weisen Männer insgesamt auf, wie sind die Unterschiede zu Frauen erklärbar und wie sind die hohen Zahlen hinsichtlich Suchtstörungen bei Männern zu reduzieren?
Jeder sechste Mann in Deutschland hat ein Alkoholproblem¹
Besonders die Abhängigkeit von Alkohol, Nikotin und illegalisierten Drogen wie Cannabis, Heroin, Amphetamin und Kokain trifft Männer deutlich öfter als Frauen. Wie die „Deutsche Erwachsenen Gesundheitsstudie“ DEGS (Lange et al., 2016) zeigte, hat mit 18.4% fast jeder sechste Mann im letzten Jahr ein relevantes Alkoholproblem (Missbrauch oder Abhängigkeit). Bei 29% der Männer (Vergleichswert Frauen: 9%), die wegen einer somatischen Erkrankung in ein Allgemeinkrankenhaus eingewiesen wurden, liegt eine alkoholassoziierte Erkrankung vor. Besonders oft werden bei ihnen neben Verletzungen infolge von Unfällen oder Stürzen sowie Frakturen Delirium tremens, Krampfanfälle, Leberzirrhose und Polyneuropathien diagnostiziert. Dies sind typische Folgeerkrankungen, die auf die Chronizität der Alkoholerkrankung hinweisen.
¹ Umfassende epidemiologische Übersichten zum Alkoholkonsum in Deutschland sind der Drogenaffinitätsstudie (Orth & Merkel, 2022) und dem Alkoholatlas Deutschland des DKFZ (Schaller, K. et al., 2022) zu entnehmen.
Alkohol im Leben von Männern – zu oft ein regelhafter Begleiter
Viele somatische und psychische Krankheiten entstehen durch chronischen Alkoholkonsum. Die Diagnose „Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol“ war 2017 der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Chronischer Alkoholmissbrauch ist mit mehr als 150 internistischen, neurologischen und psychiatrischen Diagnosen assoziiert oder erzeugt diese. Bei etwa 1,4 Millionen Menschen liegt ein Alkoholmissbrauch vor, etwa 1,6 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. Drei Viertel der Betroffenen sind Männer. Jährlich sterben in Deutschland über 60.000 Menschen an den Folgen Ihres Alkoholkonsums, davon fast drei Viertel Männer. Unter Menschen, die sich das Leben nehmen, sind nicht nur drei Viertel Männer, sondern auch besonders viele Männer mit Alkohol- und anderen Suchtproblemen.
Männer zeigen im Vergleich mit Frauen deutlich riskantere Umgangsformen mit Substanzen. Sie steigen zwar durchschnittlich im gleichen Alter (2021: 15.0 Jahre) in den ersten Konsum von Alkohol ein, entwickeln dann aber schnell einen höheren und riskanteren Konsum. Der riskantere Konsum besteht in mehr Rausch- und Intoxikationssituationen („binge drinking“). Männer vertragen körperlich zwar mehr Alkohol als Mädchen, durch ihren höheren durchschnittlichen Konsum erleiden sie aber insgesamt mehr Schäden. Die bei Männern bessere Verträglichkeit des Alkohols ist in der Realität des Alltags ein Risikofaktor für höheren Konsum und mehr Suchtentwicklungen.
Männer aller Altersstufen trinken mehr Alkohol als Frauen
Die Drogenaffinitätsstudie 2019 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Orth & Merkel, 2020) weist aus, dass im Jahr 2019 bei den 18- bis 25- Jährigen 43.9% der Männer im Unterschied zu 23.5% der Frauen im Monat mindestens viermal Rauschtrinken berichteten. Rauschtrinken („binge drinking“) ist dabei mit 5 oder mehr Gläsern (á 10g Alkohol) pro Trinkgelegenheit definiert. Dies entspricht etwa 1.2 Liter Bier oder 0.5 Liter Wein. Im Alltag nehmen Männer fast doppelt so viel Alkohol zu sich wie Frauen. 16.2 g Alkohol tgl. bei Männern stehen 8.5 g im täglichen Durchschnitt bei Frauen gegenüber.
Dass Männer mehr Alkohol als Frauen trinken, gilt für alle Altersstufen. Der übermäßige Alkoholkonsum bei Männern beginnt in der frühen Jugend und dauert bis zum hohen Alter an. Einen problematischen Alkoholkonsum (klinisch relevant nach AUDIT) zeigten im Jahr 2015 ca. 20 Prozent der 18- bis 59-jährigen Befragten auf. Die erwachsenen Männer lagen dabei mit 29 Prozent deutlich über den Frauen mit 10.5 Prozent.
Männer und Sucht – die Kombination tritt viel zu häufig auf
Im Einzelnen ist nach den vorliegenden epidemiologischen Studien von 2.5 Mill. Männern mit einem klinisch relevanten Alkoholproblem und 0.35 Mill. mit einem Drogenproblem (Cannabis, Opioide, Stimulantien) auszugehen. Bei insgesamt ca. 34 Mill. Männern in Deutschland im Alter von über 16 Jahren ist die – hier konservativ geschätzte – Zahl von knapp 3 Mill. Suchtkranken sehr hoch. Somit wären etwa 9% bzw. jeder elfte Mann von einer behandlungsbedürftigen Suchtstörung (Substanzsucht) betroffen. Hinzu kommen Verhaltenssuchtprobleme.
Welches sind die wichtigsten Risikofaktoren für eine Suchtentwicklung bei Männern? Wie ist es verstehbar, dass jeder elfte Mann an einer oder mehreren Substanzsuchtstörung leidet, oft ohne es zu wissen oder wahrhaben zu wollen? Dies schädigt sie selbst, hinterlässt aber auch im sozialen Umfeld, besonders bei Partnerinnen und Kindern negative Spuren. Es geht dabei auch um physische, sexuelle oder psychische Gewalt unter Substanzeinfluss.
Männer zeigen stärkere Risiken auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene
Das biopsychosoziale Modell der Suchtentstehung zeigt auf allen Ebenen stärkere Risikofaktoren für Männer. Diese sollten in der Prävention und Rehabilitation spezifische Berücksichtigung finden.
Vor dem Hintergrund des biopsychosozialen Modells, das ganz allgemein die Risiken für die Entstehung psychischer Störungen beschreibt, geht es im Folgenden darum, welche Merkmale die Suchtstörungen bei Männern so häufig machen. Dafür werden im Rahmen von acht Themenbereichen die wichtigsten Ergebnisse aus Forschung und Praxis dargestellt. Das folgende typische Fallbeispiel zeigt, wie schwer der Weg in einer Behandlung bei Alkoholabhängigkeit oft ist und wie lange dies auch dauern kann.
Fallbeispiel: Alkoholabhängigkeit bei einem Mann (ICD 10: F 10.2 Alkoholabhängigkeitssyndrom)
Markus (45) ist der älteste von zwei Söhnen. Sein Vater (Verkehrskraftfahrer) hatte ein chronisches Alkoholproblem und ist mit 52 Jahren bei einem Verkehrsunfall verstorben. Markus Mutter (Verkäuferin) war dependent und leicht depressiv. Er selbst hat mit 12 Jahren begonnen zu trinken und vertrug sofort mehr als seine Freunde, was sein niedriges Selbstwertgefühl deutlich steigerte. Er hatte jedoch unter Alkoholeinfluss immer wieder Streitereien mit anderen und erhielt schließlich dafür eine Jugendstrafe auf Bewährung. Seine Schulleistungen ließen in dieser Zeit rapide nach und er musste nach der 9. Klasse von der Realschule mit Hauptschulabschluss abgehen. Er begann eine Lehre als Großhandelskaufmann, die er nach einem Jahr wegen dauerhafter Konflikte mit dem Vorgesetzten abbrach. Daraufhin steigerte sich sein Alkoholkonsum.
Er lernte in dieser Zeit seine erste Freundin (Magda, heute 40) kennen. Sie bewunderte ihn wegen seiner körperlichen Kraft und der Stärke in seinem Verhalten. Nach kurzer Zeit wurde sie schwanger und sie heirateten noch vor der Geburt der Tochter (Sarah). Markus arbeitete inzwischen als ungelernte Kraft in einem Ersatzteillager einer großen Autowerkstatt. Immer wieder kam es unter Alkoholeinfluss zu Schlägereien in Kneipen, auf Plätzen und einmal auch an seinem Arbeitsplatz. Markus war, wenn er Alkohol getrunken hatte, leicht provozierbar.
Auch zu Hause verschlechterte sich die Atmosphäre mehr und mehr. Die häufigen Streitigkeiten belasteten ihn sehr und er verließ dann immer häufiger die gemeinsame Wohnung zum außerhäuslichen Trinken. Dort konnte er abschalten und alle Konflikte vergessen. Er hat jetzt auch immer häufiger suizidale Gedanken, über die er aber mit niemandem spricht. Auch fühlt er sich immer weniger imstande, seinen Verpflichtungen auf der Arbeit und im Alltag nachzukommen. Auf der Arbeitsstelle erhielt er kurz hintereinander zwei Abmahnungen, nachdem er mit dem Gabelstapler im offensichtlich intoxikierten Zustand Kisten mit Ersatzteilen herunterfallen ließ.
Bei einem der häufigen Streitereien mit der Partnerin fühlte er sich von ihr so provoziert, als sie sagte, dass er bald keine Arbeit mehr hätte und sie ihn dann verlassen werde, dass er sie schlug. Sie rief daraufhin die Polizei, die Markus für 14 Tage der Wohnung verwies. Er schlief daraufhin in einem Hotel in der Nähe. Auf dem Weg zur Arbeitsstelle am nächsten Tag fuhr er mit seinem Auto einen Radfahrer an und verletzte diesen schwer. Die Polizei stellte eine BAK von 2.2 Promille fest. Ihm droht nun ein Gerichtsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss. Daraufhin bemüht Markus sich erstmalig auf Anraten seines Hausarztes und wegen des Drucks, den er jetzt verspürt, um eine Entzugsbehandlung mit anschließender Entwöhnungsbehandlung.
II. Acht Risikobereiche für Sucht bei Männern
Die biopsychosoziale Forschung hat in den letzten Jahren etliche Resultate geliefert, um die Entstehung von Suchtstörungen bei Männern genauer zu verstehen. Langfristig sollten daraus bessere Präventions- und Interventionsprogramme entstehen, die neben den allgemein wichtigen Behandlungsansätzen auch geschlechtsspezifische Ansätze umfassen. Im Folgenden werden acht mögliche Ursachen für die hohen Suchtprävalenzen bei Männern aufgelistet, die einzeln, aber auch in Kombination, auftreten können:
(1) Biologische Besonderheiten und Risiken
Zum einen vertragen Männer mehr Alkohol als Frauen, weil bei ihnen der Wasseranteil im Verhältnis zum Fettanteil im Körper höher ist. Männer haben insofern relativ gesehen mehr Körperwasser, in dem sich der Alkohol verteilen kann und entwickeln dadurch langsamer bei Alkoholkonsum eine Intoxikation. Außerdem wurde für eine Subgruppe von Männern nachgewiesen, dass sie erblich bedingt Alkohol schneller verstoffwechseln als Frauen und andere Männer. Dieses als bessere Alkoholreagibilität – oder verallgemeinernd – „angeborene Alkoholtoleranz“ benannte Phänomen führt jedoch im Alltag dazu, dass Jungen mit dieser biologischen Besonderheit, die mit dem Alkoholkonsum einsteigen, mehr Alkohol trinken als andere (Schuckit, 1993; Schuckit & Smith, 2017). Für Jugendliche, die bei ihren ersten Konsumerfahrungen den Alkohol besser vertragen als andere, heißt dies, dass sie besonders sensibel und kontrolliert damit umgehen sollten, um eine spätere Abhängigkeit zu vermeiden. Dieses Wissen sollte durch die Gesellschaft (Medien, Schule) und die Eltern frühzeitig vermittelt werden.
(2) Die klassische Männerrolle
Die klassische Männerrolle, wie sie sich insbesondere seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verstärkt entwickelt hat, besteht aus Härte gegen sich und andere, Nicht-Wahrnehmung oder Verleugnung der eigenen Bedürfnisse, Unterdrückung negativer Gefühle, dem unrealistischen Gefühl der Unverletzlichkeit, Selbstaufopferung für Staat, Familie und Arbeit sowie Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, übermäßige Risikobereitschaft, Dominanzstreben und Führungsanspruch. Viele negative Verhaltenskonsequenzen gehören zu dieser klassischen Rolle, wie vor allem Gefühlsunterdrückung, Unberechenbarkeit, Verschlossenheit, Gewalttätigkeit, Impulsivität und Exzessivität. Um diese Rolle durchzuziehen und oft auch auszuhalten, ist für Männer Sedierung und emotionale Flucht – und damit Alkoholkonsum – im Alltag oft die einzige Lösung. Die klassische Männerrolle hat insofern für Männer viele Nachteile und wird mit mehr chronischen Erkrankungen, weniger Selbstfürsorge und kürzerer Lebensdauer assoziiert.
In Zukunft sollte es für Männer vor allem um eine Weiterentwicklung und Differenzierung ihrer Rollen und Potentiale gehen, damit sie ihr Leben in der modernen postindustriellen Gesellschaft mit mehr integrierten Anteilen hinsichtlich Empathie, Emotionsregulation, Aggressionskontrolle und partnerschaftlicher Kommunikation gelingend gestalten können. Dazu gehört auch der reflektierte, situationsangepasste Umgang mit psychotropen Substanzen. Männer sollten nicht mehr automatisch als das Geschlecht gelten müssen, das zu locker und oft besinnungslos mit Alkohol und anderen Drogen umgeht.
Selbstschädigung und Selbstaufopferung im Zuge der klassischen Männerrolle
Zu den selbstmanipulativen Rollenanforderungen, die seit der Industrialisierung verstärkt aufkamen, gehören, Gefühle von Trauer und Schmerz zu unterdrücken, Depression mit Alkohol oder Drogen zu behandeln, Ängste zu verleugnen und sich übermäßig autark zu geben. Männer haben es oft nicht gelernt oder schämen sich dafür, über die Anstrengungen und Stressgefühle, die ihnen die klassische Männerrolle bereitet, zu sprechen. Sie sind es gewöhnt, herunterzuschlucken, still zu bleiben oder von ihren Problemen abzulenken. So kam es, dass sich Männer im Zuge der Männerrolle in der industrialisierten Gesellschaft immer mehr den Rollenzwängen als Ernährer und Geldbeschaffer unterordneten und Verhaltensmuster von Selbstschädigung und Selbstaufopferung entwickelten. Der klassisch rollengebundene Mann zeigt zwar im Übermaß dominante Merkmale, ist aber auch ein Gefühlsleugner und echter Selbstverschleißer.
„Doing gender with drugs“ – Es braucht neue Wege zum Umgang mit sich selbst und mit Substanzen
Durch das schon früh angeeignete und tief verankerte männliche Alltagsverhalten wird die Geschlechterrolle immer wieder neu hervorgebracht oder bestätigt, etwa durch besonders riskantes Verhalten, mangelnde Sensibilität für sich selbst oder Selbstvernachlässigung. Dies zeigt sich nicht nur an den zuvor beschriebenen Tendenzen zur unkritischen Anpassung an herrschenden Veränderungsdruck, sondern auch durch übermäßigen Alkohol- oder Drogenmissbrauch bei Männern in Situationen, in denen ein Mehr an Gefühlswahrnehmung und –ausdruck wichtig wäre. „Doing gender with drugs“ heißt dann, als Mann, so wie es jemand in der klassischen Rolle gelernt hat, Gefühle mit Alkohol zu unterdrücken, Stress mit Drogen zu bekämpfen, statt den Umgang damit zu verändern, sich selbst zu schädigen und sich nicht zu helfen oder helfen zu lassen.
Die kurzfristig wirksame und langfristig schädliche Wesensveränderung unter Substanzeinfluss passt zur Strategie, sich stets fit und stark und keine Schwächen zu zeigen. Indem Männer wenig klagsam und sensibel für die eigenen Gefühle sind, schädigen sie sich durch Selbstvernachlässigung und mangelnde Selbstfürsorge. Durch den exzessiven Substanzkonsum in Stress- und Problemsituationen werden riskante Verhaltensweisen verstärkt und Ängste reduziert, die grundsätzlich schützende Funktionen aufweisen. Riskantes und antisoziales Verhalten wird stärker gebahnt. Aber auch der unsensible Umgang mit dem eigenen Körper in Form von chronischer Überforderung oder Ignorieren von Schmerzen und negativen Befindlichkeiten gehört zur klassischen Männerrolle.
Doch seit Jahren zeichnen sich Veränderungen der klassischen Männerrolle ab. Schon 2009 sahen sich 55% der deutschen Männer in der Männerstudie von Volz & Zulehner (2009) als suchend oder balancierend zwischen traditionellen und modernen Werten. Inzwischen hat sich dieses Pendeln zwischen alten und neuen Rollenanteilen noch verstärkt. Am ehesten ist davon auszugehen, dass eine Koexistenz zwischen alten und neuen Rollenanteile sich durchsetzen wird. Zur neuen Rolle gehören mehr aktive Vaterschaft, aktive Rolle im Haushalt, mehr Interesse an den eigenen Gefühlen, mehr freizeitbezogene Aktivitäten, mehr körperbezogene Achtsamkeit und Fürsorge.
(3) Risikofreude, Neugierde, Reizhunger
Zum evolutionären Erbe des Mannseins und in der Folge auch zur Männerrolle gehört der Reiz am Neuen, am Risiko („Thrill“), die Lust an der Exploration und die Suche nach immer weiteren Herausforderungen. Diese Risikoneigung weisen viele Männer auf und macht sie auch für impulsiven Substanzkonsum empfänglich. Viele Studien zur Persönlichkeit erbringen bei Männern höhere Werte für Risikobereitschaft, Impulsivität und Neugierde (Hartman et al., 2013). Dies bezieht sich auch auf den Umgang mit Substanzen, wo Männer häufiger Probierverhalten und wahlloses Konsumieren zeigen.
Männer zeigen in allen relevanten Kontexten extremere Verhaltensweisen, weniger Ängstlichkeit, mehr Grenzen testende Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen stellen eine Mischung aus kindlicher Neugierde, Risikobereitschaft, Lebensfreude und Abenteuerlust dar. Sie sind bei Jungen häufiger als bei Mädchen zu finden und wurzeln neben psychosozialen Einflüssen (siehe Punkt 2) auch auf biologischen und genetischen Ursachen. Das stärkere Vorhandensein von Testosteron bei Jungen ab der Pubertät begleitet und bahnt diese „typisch männlichen“ Verhaltensweisen. Der Konsum von Suchtmitteln im Kontext mit Risikoverhalten macht durchaus Sinn: Denn Suchtmittel, insbesondere Stimulantien wie Kokain und Amphetamin, steigern die Risikobereitschaft noch. Sedativa wie Alkohol oder Cannabis beruhigen die Angst, die bei riskantem Verhalten oft mit einhergeht. Insofern ist es durchaus verständlich, dass gerade männliche Jugendliche bei ihrem riskanten Verhalten Substanzen mit den genannten Wirkungserwartungen einsetzen.
Durch die Gewöhnung an den Konsum von Substanzen werden dopaminerge und endorphine Gehirnfunktionen gekapert, fremdbestimmt und der Konsument verliert mehr und mehr die Kontrolle über die eigenen Verhaltensabläufe. Daraus kann sich durch Lernprozesse (klassisches und instrumentelles Konditionieren), Gewöhnung und Wiederholungsprozesse schleichend eine Suchterkrankung entwickeln, die auch mit vielfältigen kognitiven Abwehrprozessen einhergeht. Männer zeigen im Zusammenhang mit Suchtmitteln typische Verhaltensmuster, die bei Frauen kaum bekannt sind: Neben dem Reizhunger (novelty seeking, sensation seeking) gehören dazu auch eine niedrige Belohnungsabhängigkeit (vulnerable Männer lassen sich schlechter durch soziale Konsequenzen in ihrem Verhalten steuern) und eine niedrige Schadensvermeidung (Männer werden durch drohende Schäden, Verletzungen und Unfälle in ihrem Verhalten weniger beeinflusst). Die Trias aus hohem Reizhunger, niedriger Belohnungsabhängigkeit und niedriger Schadensvermeidung ist typisch bei der Suchtentwicklung vieler junger Männer.
(4) Peer-Druck, Konformität, Zugehörigkeit
Gerade für jüngere Männer ist die Zugehörigkeit zu Gruppen von großer Bedeutung. Dies bringt Akzeptanz, Selbstwerterhöhung und sozialen Status mit sich. Oft bestehen in solchen Gruppen aber exzessive Substanzkonsumrituale, bisweilen auch gepaart mit deviantem Verhalten. Dann hängt die Akzeptanz durch die Gruppe von der Bereitschaft zum Mitmachen und zum Konformismus ab. Will der Jugendliche dazugehören, muss er die Regeln und Anforderungen der Gruppe befolgen, sich unter- und einordnen, sonst droht Ausschluss.Dadurch entsteht ein hoher Gruppendruck hinsichtlich Unterordnung und Konformismus. Es bedarf eines hohen Ausmaßes an Selbstwertgefühl und Zivilcourage, dem Gruppendruck zu widerstehen.
Es lohnt sich jedoch für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung, frühzeitig Selbstbehauptung und die Fähigkeit zum Nein-Sagen einzuüben. Gerade aber Jungen, die jünger sind als die meisten Gruppenmitglieder versuchen oft durch übertriebenes Verhalten (Substanzkonsum, Mutproben), ihre Zugehörigkeit zu sichern und ihren Status zu erhöhen. Es gilt für Jugendliche und junge Männer, Akzeptanz über andere Wege als Substanzkonsum und deviantes Verhalten zu erlangen. Diese alternativen Verhaltensweisen können über glaubwürdige Vorbilder vermittelt, aber auch generell in Sport, prosozialen Verhaltensweisen und gesellschaftlichem Engagement eingeübt werden.
(5) Angst, Depression und Selbstwertprobleme
Viele Männer unterdrücken Anzeichen emotionaler Probleme frühzeitig durch übermäßigen Substanzkonsum. Sie wissen oft nicht mit negativen Emotionen umzugehen, fühlen sich dadurch verunsichert oder bedroht und wehren die Symptome im Vorfeld durch die sedierende oder stimulierende Wirkung von Substanzen ab. Möglicherweise haben sie im Vorfeld als Junge auch nie gelernt, ihre Emotionen zu „lesen“ und können sie daher nicht differenziert einschätzen und sich nicht dementsprechend äußern. Sie wissen dann oft gar nicht, was ihre Grundbedürfnisse und Probleme sind, weil sie dies zu intensiv und frühzeitig abgewehrt haben. Viele Männer haben eine übermäßige Emotionsunterdrückung als Rollenverhalten gelernt (siehe Punkt 2).
Das hilft ihnen zwar, in kritischen Situationen nach außen hin das Gesicht zu wahren, lässt sie aber innerlich mit erhöhtem Stress und unreflektierten und nicht bewältigten Emotionen zurück. Dies kann zu einem unzureichend entwickelten oder instabilen Selbstwertgefühl führen, da wichtige intrapsychische Anteile nicht integriert wurden. Dieses Entwicklungsrisiko trifft Jungen besonders, wenn sie zu wenig Sicherheit und Bindung durch ihren Vater erfahren haben. Vielfach fehlt ihnen aus Kindheit und Jugend heraus ein väterliches Rollenmodell zur Emotionsbewältigung oder sie halten es durch ein dysfunktionales Vatermodell für normal, negative Emotionen durch Substanzen zu verdrängen.
Nicht wenige substanzsüchtige Männer sind ohne Vater oder mit einem hochgradig problematischen – weil suchtkranken, gewalttätigen oder psychisch kranken – Vater aufgewachsen (Klein, 2018). Hier gilt es, im Erwachsenenalter die Beziehung zu den eigenen Emotionen zu lernen, Substanzkonsum zu reduzieren und in eine gesunde Balance mit den eigenen Bedürfnissen (Selbstwertgefühl, Anerkennung, Lust, Entspannung) zu kommen. Dabei kann auch Selbsterfahrung als Mann oder eine Psychotherapie helfen.
(6) Stressreduktion
Viele Menschen benutzen Suchtmittel, um Alltagsstress – insbesondere im Beruf und in der Familie – zu reduzieren. Der Ablauf dabei ist einfach: Alkohol, Tabak und andere Substanzen erzeugen schnell eine stressreduzierende Wirkung, die zu Entspannung, mehr Ruhe und Gelassenheit führt. Sie ersetzen schnell und einfach Anforderungen an eine andere gelingende Methode der Stressreduktion. Alkohol und Cannabis werden oft auch gezielt als Schlafmittel eingesetzt. Sie helfen zwar beim Einschlafen, sind aber schlechte Durchschlafmittel, so dass auf längere Sicht durch ihren Konsum verstärkt Schlafstörungen entstehen können.
Gerade Männer, die oft chronischen Stress in Beruf und Familie erleben, gewöhnen sich schnell daran, Alkohol als Stressreduktionsmittel einzusetzen, nach Feierabend und vorm Schlafengehen. Dabei kann Gewöhnung und später auch Sucht entstehen. Der Prozess verläuft meist schleichend und wird zu spät erkannt, weil die Probleme und Konsequenzen des realen Verhaltens kognitiv verzerrt wahrgenommen und verarbeitet werden. Dies geschieht einerseits durch die sedierenden Effekte der konsumierten Substanzen, andererseits weil aufgrund der auftretenden Kontrollverluste starke Schamgefühle entstehen, die eine adäquate, kritische Wahrnehmung der Schädlichkeit des eigenen Verhaltens erschweren.
Auf die lange Sicht ist ein Übermaß an Alkoholkonsum zur Stressreduktion schädlich und kontraproduktiv. Männer sollten zur Stressreduktion andere Methoden einsetzen (z.B. regelmäßiger Sport, auch regelmäßige Bewegung kann schon helfen) oder neue Methoden erlernen (z.B. Entspannung, Meditation). Oft sind auch Wohlfühlmethoden an sich schon hilfreich. Als Quintessenz lässt sich festhalten: Obwohl Alkohol und andere Substanzen kurzfristig für Stressreduktion sorgen, sollten sie dafür nicht regelhaft eingesetzt werden, weil längerfristig die Nachteile überwiegen. Die langfristigen Folgen übertreffen die kurzfristigen Vorteile bei Weitem. Alkohol sollte zu Genusszwecken bestenfalls in geringen Mengen bis 30g (bei Männern) an höchsten 2-3 Tagen in der Woche eingesetzt werden, so die gültige WHO-Empfehlung.
(7) Einsamkeit als Risikofaktor für Sucht
Eine extreme Form sozialer oder emotionaler Problemlagen ist Einsamkeit. Wenn Menschen altern, erleben sie immer mehr subjektive Einsamkeit. 11 % bis 30 % der Menschen im mittleren Alter (zwischen 21 und 50 Jahren) und 40 % bis 50 % der über 80-Jährigen fühlen sich „manchmal“ bis „oft“ einsam. Risikofaktoren, die zu Einsamkeit beitragen können, treten häufiger auf, wenn Menschen älter werden. Diese Risikofaktoren sind der Verlust von Arbeit, Unabhängigkeit, Mobilität und der Tod von nahestehenden Personen. Ein weiterer Faktor ist Stress aufgrund finanzieller Einbußen, die das Rentenalter mit sich bringen kann. Natürlich erleben auch jüngere Menschen oft quälende Formen von Einsamkeit. Zur Ablenkung oder Beruhigung sowie zum Stillen von Langeweile greifen jüngere wie ältere Menschen – und hier besonders Männer – zum Alkohol. Einsamkeitsforscher beschreiben schon lange, dass Einsamkeit besonders häufig bei Männern mit einem ungesunden Lebensstil, wie Rauchen oder Alkoholkonsum, einhergeht.
Die Abnahme motorischer Fähigkeiten im Alter führt zusätzlich zu erhöhter Isolation, da die Menschen an ihre häusliche Umgebung gebunden sind. Außerdem stehen Depressionen und Angststörungen im Zusammenhang mit Einsamkeit. Einsamkeit wird zudem mit der Entstehung von Demenz assoziiert. Es wird unterschieden zwischen sozialer Einsamkeit, also dem Fehlen von Freunden und einer Gruppenzugehörigkeit, sowie emotionaler Einsamkeit, welche als das Fehlen von tiefen Bindungen zu nahestehenden Personen verstanden wird. Soziale Einsamkeit wird vor allem bei Männern festgestellt und bei Personen, die ein geringeres allgemeines Aktivitätslevel aufweisen. Beide Formen von Einsamkeit resultieren häufig aus Verlusterlebnissen (schmerzhafte Trennungen, Todesfälle, aber auch Arbeitsplatz- und Wohnungsverlust), aufgrund eines geminderten Selbstwertgefühls oder aufgrund von finanziellen und sozioökonomischen Problemen.
Einsamkeit bei Männern hängt besonders eng mit erhöhtem Alkoholkonsum zusammen. Zur Bewältigung von alkoholassoziierten Einsamkeitsproblemen bei Männern bedarf es proaktiver Ansprache durch das Umfeld, Angebote zur Verbesserung der sozialen Situation und der Soziabilität. Im Falle emotionaler Einsamkeit in Verbindung mit Suchtproblemen sollte auf jeden Fall eine Psychotherapie erwogen werden.
(8) Abhängigkeits-Autonomiekonflikt
Männer weisen oft ein intrapsychisches Muster auf, einerseits sehr hohe Autonomie leben zu wollen, andererseits aber eine Sehnsucht nach engen, bisweilen symbiotischen Beziehungen zu hegen. Sie pendeln in ihrem Verhalten zwischen diesen Polen und finden dann keine stabile Balance, insbesondere wenn sie keine Partnerschaft haben oder ihre Partnerin andere Beziehungswünsche an sie hat. Dieser innere Konflikt, der auch als Abhängigkeits-Autonomiekonflikt (AAK) oder neuerdings auch als Individuation-Abhängigkeitskonflikt bezeichnet wird, taucht auffallend oft bei suchtkranken Männern auf.
Der Abhängigkeits-Autonomiekonflikt bezieht sich auf die Suche nach Bindung und Beziehung einerseits und das Streben nach Unabhängigkeit und Autonomie andererseits. Letzteres kann sich auch in Angst vor Bindung und damit verbundener Verantwortung zeigen. Dieser Konflikt ist ein lebensbestimmendes Thema, überragt alle anderen Konflikte und kann zu einem dauerhaften intrapsychischen Stress führen, wenn er nicht aufgelöst wird.
Auf der einen Seite kann eine große Angst bestehen, dass eine wichtige Bindung zerbricht. Männer haben sich dann auf eine übermäßige Abhängigkeit ein einer Beziehung eingelassen, um Versorgung und Behütung („Bemutterung“) zu erhalten. Ihren Wunsch nach Autonomie nehmen sie gar nicht oder zu spät wahr. Die eigenen Bedürfnisse sind dann weniger wichtig, sie sind bereit, sich selbst nicht wichtig zu nehmen oder zu vernachlässigen. In diesem Verhaltensmodus spielen Männer eher den passiven Part, sind dependent und unterwürfig und zeigen keine eigene Meinung (passiver Modus). Alkoholkonsum dient dann der Betäubung von negativen Emotionen im Zusammenhang mit der übermäßig dependenten Rolle oder hilft bei kurzzeitigen Ausbrüchen aus der Rolle.
Im gegenteiligen Modus, der übertriebenen Autonomie, ist das wichtigste Ziel im Leben jederzeit das Herstellen und Erhalten einer emotionalen und existentiellen Unabhängigkeit. Das Bedürfnis nach Bindung, Anlehnung und Unterstützung wird weitgehend unterdrückt oder verleugnet. In diesem, überaktiven Modus wollen Männer jederzeit die Kontrolle über alle Abläufe und Geschehnisse haben und fürchten allzu enge Bindungen, weil sie dann die Kontrolle über sich selbst verlieren könnten.
Fazit
Die dargestellten acht Risikomerkmale für Suchtentstehung bei Männern sind zentrale Bereiche, welche die Entstehung problematischen oder süchtigen Konsumverhaltens beschreiben, aber sie sind keineswegs unabänderlich. Das Präventions- und Hilfesystem ebenso wie Familie und Schule können schon im Vorfeld eine Menge dagegen tun, dass es nicht zu einer Suchtentwicklung kommt.
III. Prävention, Empfehlungen und Lösungen: Männer und Sucht
Um die zuvor beschriebenen acht Hauptrisikofaktoren für eine Suchtentwicklung bei Männern in präventive Handlungsstrategien umzusetzen, ungünstige Entwicklungen zu verhindern und das Entwicklungspotential von Jungen weitestgehend zu fördern, braucht es neben allgemeinen etablierten vor allem innovative, geschlechtersensible Präventions- und Hilfestrategien. Diese werden im Folgenden kursorisch beschrieben. Die relevanten Implikationen für Jungenarbeit, Jugendhilfe, Prävention und Suchthilfe kommen dabei evident zu Tage.
Jungen brauchen heutzutage stärker denn je eine Lobby für Hilfen in Familien, Schule, Gesellschaft und Medien. Was getan werden sollte und könnte, lesen Sie im Folgenden.
Rollenmuster
Das klassische männliche Rollenmodell gilt es zu modernisieren und zu flexibilisieren, ohne die positiven Aspekte des Mannseins und die grundlegenden Anforderungen an das Mannsein aufzugeben. Stärke, Gelassenheit, Souveränität, Autonomie- und Bindungsfähigkeit sowie Mitgefühl und Emotionsregulation sind Eigenschaften, die Männer auf jeden Fall entwickeln und aufweisen sollten – und wenn sie in der Kindheit gute Rollenmodelle dafür haben, gelingt dies besonders gut. Starke und zugleich liebevolle Väter sind eine besonders wichtige Voraussetzung hierfür. Jungen brauchen keine verunsicherten, sondern starke und empathische Väter.
Jungen tut es nicht gut, wenn Männer in Medien und Öffentlichkeit als toxisch, gefährlich oder tollpatschig und lebensuntüchtig dargestellt werden. Das männliche Rollenmodell im 21. Jahrhundert, das auch vor Sucht schützen kann, muss eine Synthese aus Empathie, Fürsorge, persönlicher Stärke und Selbstbewusstsein darstellen. Das alte Rollenmodell hat gerade auch Männer selbst geschädigt, sie abhängig und gehorsam gemacht von vermeintlichen Autoritäten, ihr Leben insgesamt beeinträchtigt und verkürzt. Daher muss ein neues Rollenmodell den Jungen und Männern mehr Freiheit und Selbstbestimmung über ihr Leben (Arbeit und Beziehungen) bringen. Das umfasst auch die Abkehr von suchterzeugenden Haltungen und Verhaltensweisen.
Selbstbewusste und sensible Jungen
Wenn Jungen die genannten Eigenschaften – vor allem Stärke und Sensibilität zugleich – frei von Stress und Überforderung entwickeln können, sind sie gut gegen Suchtentwicklungen geschützt. Im Kern geht es um die Entwicklung ihrer vitalen Grundbedürfnisse, wie Selbstwerterhöhung, Zugehörigkeit und lustvolle Erlebensfähigkeit.
Dafür sollten sie frühzeitig Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Emotionen, ihrer Haltungen sich selbst und anderen gegenüber und eines gesunden Selbstwertgefühls erhalten. Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer sind hier wichtige Akteure, deren Bemühungen koordiniert in ein balanciertes Junge-Sein führen können. Mit Balanciertheit ist der Ausgleich zwischen Stärke und Schwäche, Risiko und Vorsicht, Mut und Ängstlichkeit gemeint. Hier helfen besonders männliche und noch besser väterliche und großväterliche Rollenmodelle. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass Väter anwesend sein können und wollen, wenn ihre Kinder aufwachsen. Dies erfordert ein entsprechendes Scheidungs- und Umgangsrecht in Deutschland. Jährlich verlieren hierzulande aber in mehr als 100.000 Fällen Kinder den Kontakt zum bindungswilligen Vater durch ein ungerechtes Scheidungsfolgensystem, das die Väter systematisch benachteiligt. Väter sollten genügend Zeit und Gelegenheit haben, mit ihren Kindern zusammen zu sein, und weder durch übermäßige Arbeitsbelastung noch durch ungerechte Umgangsregelungen nach Scheidung von ihren Kindern entfremdet werden.
Um Männer zu werden, brauchen Jungen viel mehr geschlechtssensible Erziehung
Für Jungen ist es wichtig, im Kontext von Familie und Schule ihre Grenzen zu erproben, den Umgang mit Aggressivität und Konfliktlösungen zu erlernen sowie sich Selbstwert und Emotionsregulation anzueignen. Moderne Bildungssysteme müssen im Sinne einer umfassenden mentalen und psychischen Gesundheitsförderung und Prävention neben den geschlechtsunspezifischen Bedürfnissen immer fokussierter auch die geschlechtsspezifischen Anteile von Jungen und Mädchen berücksichtigen. Was gar nicht geschehen darf, ist, Jungen den Eindruck zu vermitteln, sie seien aufgrund ihres Geschlechtes defizitär oder gar gefährlich, wie dies im Konzept der „toxischen Männlichkeit“ in einseitig generalisierender Weise und unter Vernachlässigung der Merkmale und Realitäten der Mehrheit der Männer heutzutage allzu oft geschieht. Wenn Jungen keine Akzeptanz für sich erfahren und sich abgelehnt fühlen, wächst die Gefahr, dass sie sich mit ebenfalls zurückgewiesenen anderen Jungen zusammentun.
Auf diese Weise können problematische Peer-Gruppen entstehen, die den marginalisierten Jungen im Binnenverhältnis Aufwertung und Selbstwertgefühl geben, sich gegenüber anderen Gruppen aber abkapseln und isolieren. Dann sind in den marginalisierten Peer-Gruppen oft auch früher Substanzkonsum und riskantere Verhaltensweisen zu finden. Auch radikalisierte und deviante Muster können entstehen. Derartige Entwicklungen können nur durch frühzeitige Integrations- und Akzeptanzbemühungen aufgehalten und im Idealfall verhindert werden. Der frühe Alkohol- und Drogenkonsum dient den Jungen auf dem Weg zu devianten Gruppen als Zeichen der Nonkonformität, der Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft und zur Übersteigerung der eigenen expansiven Verhaltenstendenzen.
Jungen brauchen glaubwürdige Vorbilder
Jungen brauchen Vorbilder für Mut und Zivilcourage, damit sie nicht von Peers, insbesondere solchen, die etwas älter sind als sie selbst, manipuliert und zu Konformität und Substanzkonsum gebracht werden. Es ist eine wichtige Kompetenz in Gruppen Jugendlicher, dem Peer-Druck widerstehen zu können und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Dies gilt besonders für Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum und deviante Verhaltensweisen und betrifft daher häufiger Jungen als Mädchen. Jungen brauchen glaubwürdige Vorbilder und Anleitung, wie sie am besten soziale Zugehörigkeit und Autonomie unter einen Hut bringen können, um die latenten Autonomie-Abhängigkeitskonflikte früh zu bewältigen. Auch hierfür sind Väter, Stiefväter und Großväter ideal, wenn sie ihre Aufgabe verstehen und mit Herzblut ausführen. Natürlich können auch Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter hier wichtige Arbeit leisten und viel Gutes bewirken. Durch die oft vorhandene Vaterlosigkeit im Leben von Jungen drohen jedoch dysfunktionale und problematische Entwicklungen.
Viel zu selten werden Jungen Hilfen zur Entwicklung der Männlichkeit gegeben, die ihren natürlichen Anlagen und inneren Zielen entspricht. Auch sollten die Themen, wie sie zu Männern mit Selbstwertgefühl, Gelassenheit, Stärke, Ausstrahlung und Empathie werden können, ganz im Vordergrund stehen. Schließlich sind männliche Sexualität und Erotik zentrale Themen, die abseits von Rollen- und Leistungsdruck in der Familie, aber auch in Schule und Medien, erörtert werden sollten. All dies sind wichtige suchtpräventive Maßnahmen, da Jungen mit psychischer Stärke und Gelassenheit am besten gegen psychische Probleme – und insbesondere Sucht – geschützt sind.
Modellhafte Ansätze
Obwohl bislang männer- und jungenspezifische Ansätze in der Suchthilfe selten auftauchen, sind erste Modelle vorhanden. Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist das Programm „Männlichkeiten und Sucht“ (Bockhold et al., 2017) entwickelt worden. Ein weiteres, spezielleres Modell mit dem Namen VIKTOR fokussiert auf ältere, einsame Männer mit Alkoholproblemen (Klein et al., 2023). Im Rahmen des 10 Module umfassenden Programms lernen sie, Einsamkeits- und Alkoholprobleme zu erkennen und zu bewältigen. Noch ist das Suchthilfesystem insgesamt zu wenig auf die Problemlagen und Bedürfnisse von gefährdeten Jungen und abhängigkeitskranken Männern eingestellt. Es bedarf weitergehender geschlechtssensibler Hilfen, die bei den genannten Risikofaktoren ansetzen und diese bearbeiten.
Fazit für die Praxis
Die hohe Zahl suchtkranker Männer macht eine nachhaltige Öffnung des psychotherapeutischen Hilfesystems für diese Patientengruppe nötig. Noch werden zu wenige Betroffene erreicht. Dafür sind geschlechtssensible und motivationsförderliche Ansätze nötig. Die Funktionalität der Suchterkrankung im Leben von Männern hat einen engen Bezug zur Geschlechtsrolle, zu Hyperstresserleben, familialen Vorbelastungen, Emotionsregulationsproblemen und Einsamkeitserleben. Immer noch werden zu viele Betroffene abgewiesen, weil sie nicht den angeblich nötigen Leidensdruck und die erwartete Therapiemotivation von Anfang an zeigen. Dabei sind dies bei einer Suchterkrankung gerade die krankheitstypischen Unterschiede zu anderen psychischen Störungen. Bei Männern ist die Abwehr gegen die Akzeptanz der Sucht oft besonders stark. Die in der Psychotherapie tätigen Fachkräfte können durch Frühintervention, zieloffene Suchttherapie und geschlechterreflektierte Interventionen wichtige Beiträge zur Verbesserung der Versorgungslage leisten und damit mehr Jungen und Männern helfen.
Literatur
Bockhold, P., Stöver, H. & Vosshagen, A. (2017; 3. überarb. Auflg). Männlichkeiten und Sucht. Handbuch für die Praxis. Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Koordinationsstelle Sucht (Reihe: Forum Sucht, Sonderband 4).
Hartman, C., Hopfer, C., Corley, R. Hewitt, J. & Stallings, M. (2013). Using Cloninger’s Temperament Scales to Predict Substance-Related Behaviors in Adolescents: A Prospective Longitudinal Study. Am J Addict 22(3), 246-251.
Klein, M. (2018). Kinder im Kontext elterlicher Alkoholsucht. Suchtmedizin 20 (1), 52 – 62.
Klein, M., Eschweiler, R., Kemper, N., Lich, K. & Winter-Wilms, F. (2023). VIKTOR – ein männerspezifisches Gruppenprogramm zur Reduktion von Einsamkeits- und Alkoholproblemen. Lengerich: Pabst.
Lange, C. Manz, K., Rommel, A., Schienkiewitz, A. & Mensink, G. (2016). Alkoholkonsum von Erwachsenen in Deutschland: Riskante Trinkmengen, Folgen und Maßnahmen. Journal of Health Monitoring 1(1), 2-21.
Orth, B. & Merkel, C. (2020). Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2019. Rauchen, Alkoholkonsum und Konsum illegaler Drogen: aktuelle Verbreitung und Trends. BZgA-Forschungsbericht. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA).
Orth, B. & Merkel, C. (2022). Der Substanzkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland. Ergebnisse des Alkoholsurveys 2021 zu Alkohol, Rauchen, Cannabis und Trends. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA).
Schaller, K. et al. (2022). Alkoholatlas Deutschland 2022. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ).
Schuckit, Marc A. (1993). Reaction to Alcohol as a predictor for alcoholism. Alcohol Alcohol Suppl. 2:91-94.
Schuckit MA, Smith TL (2017) Mediation of effects of the level of response to alcohol and impulsivity 15 years later in 36-year-old men: Implications for prevention efforts. Drug Alcohol Depend 180:356–362.
Volz, P. & Zulehner, M. (Hrsg.) (2009). Männer in Bewegung. Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland. Baden-Baden: Nomos.
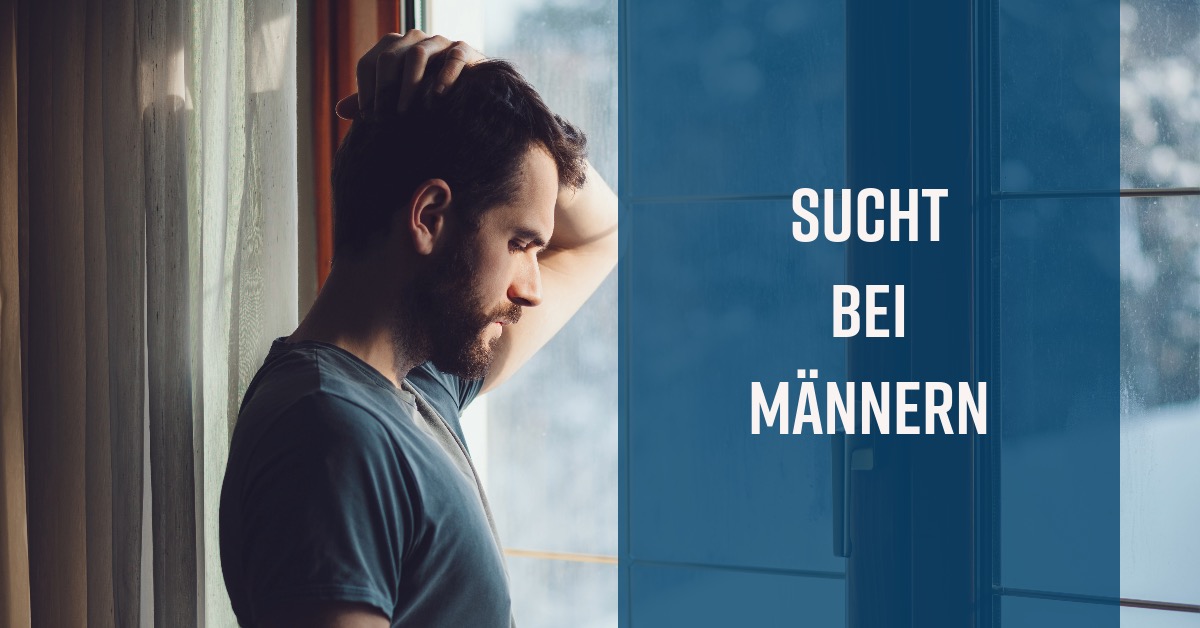
One thought on “Sucht bei Männern – zentrale Ursachen, geschlechtssensible Hilfen und mehr Prävention”