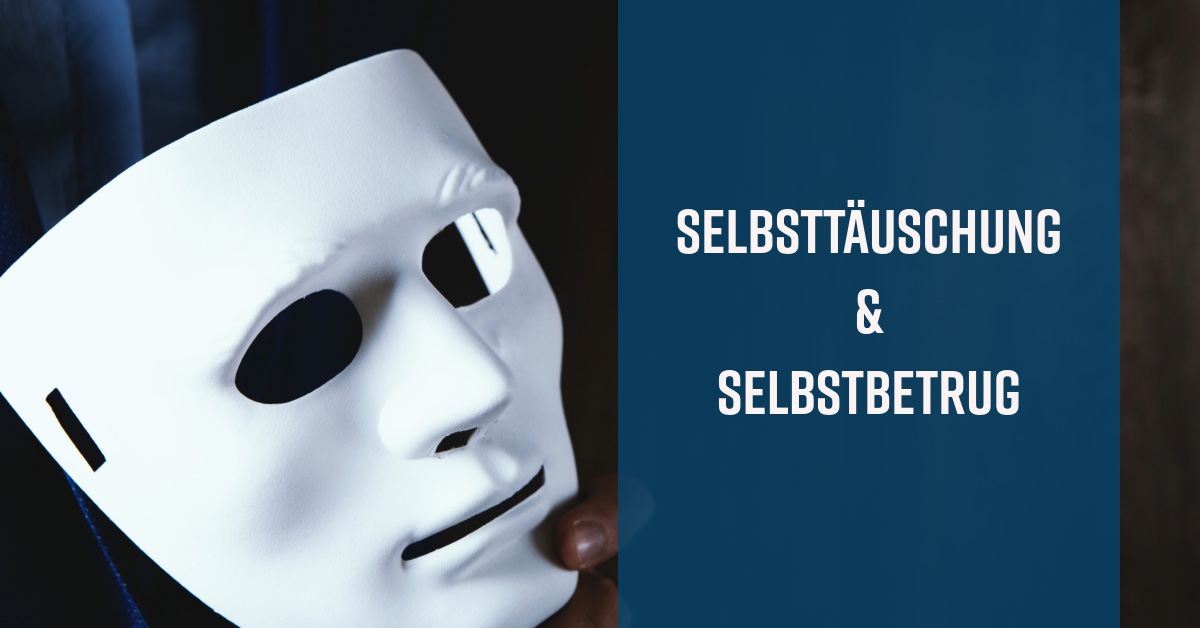Angehörige und Fachkräfte sind immer wieder erstaunt, wie weit die Selbsttäuschung bei Suchtkranken reichen kann. Selbst die offensichtlichsten Fakten können verleugnet oder ins Gegenteil verdreht werden. Es kann auch sein, dass selbst klarste Tatsachen, etwa wie viel eine Person trinkt, von ihr selbst nicht adäquat wahrgenommen werden. Diese Phänomene werden durch intensive kognitive Abwehrprozesse (vgl. Sucht als Wahrnehmungs- und Denkstörung: Kognitive Abwehr und Verzerrungen bei Suchtstörungen (Sucht und Kognition #1)), die einerseits Vorausbedingung, aber noch mehr Folge der Sucht sein können, erzeugt.
Die Verzerrung der Realität ist ein Kernmerkmal der entstehenden, vor allem aber der chronifizierten Suchterkrankung. Auch Suchtkranke selbst erkennen dies in der Rückschau, wenn sie ihre Sucht überwunden haben, und sind oft erstaunt, wie weit dieser Verzerrungsprozess bei ihnen gegangen ist. Mit dieser Erkenntnis können sie anderen Suchtkranken oft auch eine wichtige Hilfe zur Selbstreflektion und besseren Selbsterkenntnis sein, vor allem in den Suchtselbsthilfegruppen und in ambulanten oder stationären Gruppentherapien. Angehörige erleben oft kopfschüttelnd, wie sehr ihr süchtiger Partner das Offensichtliche nicht sieht und anders darstellt.
Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass zu den relevanten Entstehungs- und Aufrechterhaltungsbedingungen von Suchterkrankungen (Das „Psycho“ im biopsychosozialen Modell der Sucht – die psychologischen Zugänge zur Entstehung und Behandlung) besonders kognitive Selbsttäuschungsaspekte gehören. Gerade weil exzessiver Substanzkonsum eng mit dem Streben nach emotionaler und affektiver Selbstmodifikation (vgl. „In the Mood“ – Mood-Management: Theorie und Praxis. Eine Betrachtung aus Sicht der Suchtprävention und Suchthilfe) zusammenhängt, können kognitive Abwehrstrategien diesen Prozess harmlos und ungefährlich erscheinen lassen. Den problematischen Substanzkonsum von Anfang an kritisch und wach zu reflektieren, kann entscheidend vor einer Suchterkrankung schützen, genauso wie es wichtig ist, die Motive eines übermäßigen Substanzkonsums zu reflektieren. Gerade wenn der übermäßige Substanzkonsum kurzfristig positive Folgen (positive und negative Verstärkung) hat, sind die langfristigen dysfunktionalen Folgen (soziale Isolation, Einsamkeit, Trennung) umso mehr in den Blick zu holen. Deshalb spielen kognitive und motivationale Therapien bei Sucht (z.B. Kognitive Verhaltenstherapie, Rational-Emotive-Therapie, Motivational Interviewing) eine so große Rolle.
Inhaltsübersicht
Das Wesen des Selbstbetrugs
Alltagssprachlich werden die kognitiven Abwehrprozesse bei der Verzerrung der Realität auch als Selbstbetrug bezeichnet, was impliziert, dass der Suchtkranke nicht nur sein Umfeld unter Stress setzt und schädigt, sondern sich letzten Endes auch selbst schadet.
Alle Menschen betreiben ein gewisses Ausmaß an Selbsttäuschung, wie psychologisch schon lange bekannt ist. Selbsttäuschung ist eine hohe Kunst, um Selbstwertgefühl zu erhalten und zu steigern, aber zu viel davon ist ein Fehler, der zu vielen Problemen mit sich und der Umwelt führt.
Es braucht daher Korrektive, wenn dieser Prozess überhandnimmt und schädlich wird. Selbsttäuschung bezeichnet das aktive Vermeiden oder Verzerren von Realität, um sich selbst psychisch zu entlasten. Bei Sucht dient sie vor allem dazu, das Konsumverhalten vor dem eigenen Gewissen zu rechtfertigen, innere Konflikte zu vermeiden und ein zerbrechendes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Ein starkes, chronisches Ausmaß von Selbsttäuschung bedeutet Selbstbetrug. Dieser ist nicht statisch, sondern dynamisch. Je näher und unerträglicher die Realität rückt (z. B. durch Konflikte, Krankheit, Konfrontation mit Angehörigen und Vorgesetzten), desto intensiver können die kognitiven Abwehrmechanismen werden. Gleichzeitig ist Selbstbetrug nicht unüberwindbar – er kann durch ehrliche soziale Beziehungen, Spiegelung und Selbsterkenntnis allmählich hinterfragt und verändert werden.
Selbsttäuschung: Mehr als eine starke Kurzsichtigkeit
In der Suchttherapie wird zur Verdeutlichung der Probleme übermäßiger Selbsttäuschung gerne die Metapher benutzt, dass die Sucht eine Augenerkrankung sei, um auf die enormen Wahrnehmungsveränderungen von Suchtkranken hinzuweisen. Der amerikanische Suchtforscher Claude M. Steele verglich die Sucht mit einer starken Kurzsichtigkeit, weil nur die kurzfristig nützlichen Folgen des Konsums gesehen, die langfristig schädlichen Folgen aber ausgeblendet werden. Natürlich bedeutet die Selbsttäuschung bei Sucht mehr als das: Die ganze Wahrnehmung und Ereignisverarbeitung, die kognitive Organisation des Betroffenen, ist auf Abwehr und Verzerrung ausgelegt, um das psychische Gleichgewicht zu erhalten. Die Metaphern machen aber deutlich, wie stark die Realitätswahrnehmung unter dauerhaftem Substanzkonsum verändert ist. Es handelt sich um einen mentalen Anpassungsprozess, der die Realität erträglicher macht, aber auch das Ausmaß des Substanzkonsums vor sich selbst verharmlost. Ein einmal etabliertes Muster von Selbstbetrug ist schwer zu durchbrechen, weil es zunächst selbstwertdienlich verhindert, dass die ganze, oft schockierende, Tragweite des selbstbezogenen Problems erkannt wird.
Warum Selbstbetrug ein Teil der Sucht ist
Bei Suchterkrankungen zeigt sich Selbstbetrug in seiner reinsten Form. Der Suchtkranke entwickelt viele Formen kreativen Selbstbetrugs: Leugnen, Bagatellisieren, Verniedlichen, aggressives Abstreiten, Projizieren, Spalten, Vergessen uvm. Mehr und mehr wird der Selbstbetrug zum Lügengebäude (vgl. Sind Suchtkranke Lügner? – Einsichten und Hilfsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige (Sucht und Kognition #3)). Selbstbetrug als Lüge trifft die Angehörigen als Fremdbetrug mit voller Wucht. Für sie ist die Innenwelt des Suchtkranken anfangs voller Rätsel und Widersprüche, weil ihnen die Natur und Motivation der kognitiven Abwehrprozesse verschlossen bleibt.
Wenn man suchtkrank ist, erlebt man oft einen inneren Zwiespalt: Ein Teil von einem weiß, dass das eigene Verhalten selbstschädlich ist. Ein anderer Teil will es nicht wahrhaben oder findet immer wieder gute Gründe, warum es “doch okay” ist. Insgesamt siegt dann immer wieder die selbsttäuschende Seite. Das ist kein Zeichen von Bosheit oder Schwäche. Es ist vielmehr ein Schutzmechanismus bei Ambivalenz: Selbstbetrug.
Selbstbetrug hilft kurzfristig dabei, mit unangenehmen Gefühlen wie Scham, Angst, Depressivität oder Schuld umzugehen. Doch langfristig hält er die Sucht in Gang und macht sie zum inneren Gefängnis. Durch kontinuierliche Selbstindoktrination mit falschen Sätzen („Ich bin nicht süchtig“, „Ich kann jederzeit aufhören“, „Andere sind schuld“ usw.) wird der Selbstbetrug aufrechterhalten und zum Teufelskreis. Der Suchtkranke wird durch Zweifel, Schuld- und Schamgefühle einerseits und durch den als Schutz gedachten Selbstbetrug andererseits zum innerlich gespaltenen Menschen.
Ambivalenz und Spaltung werden so auf Dauer zu einem Teil der süchtigen Identität. Der Suchtkranke spürt seine letztendliche Wahrheit, aber kann sie (noch) nicht integrieren, solange mächtige Gefühle von Scham (Scham – Die Kernemotion der Sucht (Sucht und Emotionen #10)), Schuld und Angst vorherrschen. Wenn man sich selbst nicht ehrlich begegnet, wird Veränderung unmöglich. Es braucht einen Schritt aus dem inneren Gefängnis, dessen Tür im Prinzip nicht verschlossen ist, sondern nur so scheint. Der Suchtkranke selbst hat den Schlüssel, sich zu befreien.
Die tiefenpsychologische Dimension des Selbstbetrugs
In der Psychologie gelten Selbsttäuschung und Selbstbetrug als Phänomene, die in niedriger Dosierung sogar notwendig ist, um Selbstwert und psychische Gesundheit zu stabilisieren. Es kommt also auf das Ausmaß und die Häufigkeit des Selbstbetrugs an, damit dieser nicht mehr funktional, sondern pathologisch ist.
Selbstbetrug ist eng mit Abwehrmechanismen, kognitiven Verzerrungen und unbewussten Prozessen verbunden ist. Sigmund Freud beschrieb bereits, dass das Ich dazu neigt, schmerzhafte Wahrheiten durch Verdrängung, Rationalisierung oder Projektion abzuwehren. Seine Tochter, Anna Freud, entwickelte später ein komplexes Theoriesystem der Abwehrmechanismen, die um Verschiebung, Verleugnung, Verzerrung, Rationalisierung, Intellektualisierung und viele andere erweitert und differenziert wurden. Selbstbetrug kann dabei als eine innere Inszenierung verstanden werden, in der das Subjekt zum Täter und Opfer zugleich wird. Es reagiert mit dem Selbstbetrug auf Zumutungen in seiner Kindheit, aber schädigt durch seine Verzerrungen, Lügen und Zuspitzungen auch wieder andere.
Oft steht dieses Selbstbetrugsmuster in einer generationalen Folge und wird weitergegeben. Einer der bedeutendsten Schüler von Freud, C.G. Jung, sah in der Persona – der sozialen Maske – ein Medium der Selbsttäuschung. Je nach dem, wie sich eine Person von früh an entwickelt hat, kann ihre Persönlichkeit ein Mittel der extremen Selbsttäuschung sein. Dieses Faktum trifft auf Persönlichkeitsstörungen und oft auch auf – bisweilen komorbid auftretende – Suchterkrankungen zu. Manchmal wird dieses Phänomen auch damit beschrieben, dass der innere Spiegel zur Selbsterkenntnis schon in der Kindheit dauerhaft zerbrochen wurde.
Die kognitionspsychologische Dimension des Selbstbetrugs
Die moderne Kognitionspsychologie spricht von „motivated reasoning“: Informationen werden nicht neutral verarbeitet, sondern so gedeutet, dass sie das bestehende Selbstbild und die eigenen Wünsche stützen. Beispiele finden sich in alltäglichen Situationen. Ein Mensch, der schon abhängig ist, spielt seinen täglichen Alkoholmissbrauch herunter, indem er an der Vorstellung festhält, jederzeit mit dem Konsum aufhören zu können. Eine Person in einer toxischen Partnerbeziehung rechtfertigt immer wieder das gewalttätige Verhalten des Partners, um nicht die schmerzhafte Konsequenz eines Ausstiegs ziehen zu müssen. In beiden Fällen wird Realität so umgedeutet, dass sie kurzfristig erträglicher erscheint. Auf die lange Sicht chronifiziert sich das Problem immer mehr.
Wie eigene Widersprüche zu Selbstbetrug führen
Psychologisch betrachtet, erfüllt Selbstbetrug eine doppelte Funktion. Einerseits schützt er akut vor der unmittelbaren Überforderung durch die belastende Erkenntnis der ganzen Realität. Andererseits erzeugt er langfristig eine Diskrepanz zwischen innerem Erleben und äußerer Wirklichkeit. Diese Diskrepanz kann zu chronischem Stress, Selbstentfremdung und schließlich zu psychischen Störungen führen. Wie die Theorie der kognitiven Dissonanzreduktion (Leon Festinger, 1919 – 1989) in Tausenden von Experimenten gezeigt hat, halten Menschen die innere Spannung, die sich aus den Unterschieden zwischen Realität und Subjektivität ergibt, nicht aus und neigen dann stark dazu, ihre Realität subjektiv zu verändern. Diese dann als schöner, positiver und problemloser zu erleben, ist die häufigste Form der kognitiven Dissonanzreduktion. Diese dient dann zur inneren Selbstrechtfertigung des eigenen Verhaltens („Ich kann jederzeit aufhören!“).
Studien aus der Resilienzforschung zeigen zusätzlich, dass Menschen mit geringer Fähigkeit zur Selbstreflexion stärker dazu tendieren, unangenehme Wahrheiten zu verleugnen, und dadurch ein längerfristig höheres Risiko für depressive oder angstbezogene Symptome aufweisen.
Auch auf der Ebene sozialer Beziehungen wirkt Selbstbetrug destruktiv. Wenn das Selbstbild zu weit von der Realität abweicht, entstehen Missverständnisse, Enttäuschungen und Vertrauensbrüche. Die Person wirkt entrückt und unrealistisch. Psychotherapie stößt häufig genau an dieser Stelle auf Widerstände. Patienten halten an Selbstbildern fest, die zwar entlastend wirken, aber jede Veränderung verhindern. Psychotherapie muss deshalb oft darin bestehen, den Selbstbetrug behutsam offenzulegen, ohne den Schutz, den er bietet, abrupt zu zerstören. Dies ist besonders oft bei Sucht und Persönlichkeitsstörungen der Fall.
So zeigt sich in der psychologischen Betrachtung, dass Selbstbetrug eine ambivalente Rolle spielt: Er dient kurzfristig als Rettungsanker, birgt jedoch langfristig erhebliche Gefahren für psychische Gesundheit und soziale Beziehungen.
Gründe für Selbsttäuschung im Suchtprozess
Die starken gewohnheitsmäßigen Selbsttäuschungen, die bei Suchterkrankungen auftreten und zu chronischem Selbstbetrug führen können, haben verschiedene Ursachen. Die häufigsten sind:
(1)
Die im Suchtprozess vorherrschende starke Substanzwirkung (periodisch oder noch häufiger kontinuierlich) verändert die Wahrnehmung der Realität. Sie sediert, stimuliert und zeichnet ein anderes Bild der Umwelt und vor allem von sich selbst, als dies tatsächlich gegeben ist. Die Selbstwahrnehmung wird positiver, ohne dass sich das Selbst geändert hat. Daran gewöhnt sich das Selbst. Auf Dauer wird es immer schwerer, Bild und Trugbild zu unterscheiden, vor allem wenn das Trugbild um ein Vielfaches angenehmer und positiver ist als die Realität.
(2)
Die Abwehr der unerwünschten Realität erzeugt immer stärkere kognitive Verzerrungen. Was ursprünglich zu einer Steigerung des Wohlbefindens oder einer Dämpfung von Angst, depressiven Gefühlen oder anderen problematischen Emotionen eingesetzt wurde, muss mehr und mehr verzerrt wahrgenommen, vor allem in seinem Ausmaß verharmlost und bagatellisiert werden. Diese als Abwehrstrategien zu verstehenden kognitiven Verzerrungen dienen dazu, das Selbstwertgefühl vor der Wahrnehmung des Kontrollverlusts und der Ohnmacht gegenüber dem Suchtmittel zu schützen. Kein Mensch konfrontiert sich gerne mit seinen Ohnmachtsgefühlen und Kontrollniederlagen.
(3)
Aufgrund der immer größer werdenden Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und substanzinduzierter subjektiver Welt muss die harte Realität mehr und mehr verzerrt und abgewehrt werden. Weil der Dauerkonsument von Substanzen diese Diskrepanz spürt und nicht auflösen kann, entwickelt er mehr und mehr eine innere Scheinwelt. Die Lösung, die eigene Ohnmacht gegenüber dem Suchtmittel zuzugeben und nach einer Veränderung zu streben, kommt zunächst nicht in Betracht, weil man sich durch die Substanzwirkung stark und überlegen fühlt. Sie erzeugt ein künstliches Gefühl von Stärke und Unangreifbarkeit, das der Betroffene jedoch nicht missen möchte. Es entsteht eine starke kognitive Dissonanz zwischen Realität und Scheingefühl, die nur durch Abwehr der Wahrnehmung des eigenen Kontrollverlusts erträglich wird.
(4)
Weil die Substanzwirkung immer wieder Lücken oder Pausen aufweist, entsteht im Hintergrund der Wahrnehmung Scham. Der Abhängige spürt innerlich, dass etwas an seinem Verhalten nicht stimmt, dass er keine Kontrolle über wichtige Funktionen mehr hat. Auch durch die Rückmeldung von Angehörigen oder reale Fehlhandlungen, können Schamgefühle entstehen. Diese müssen sofort unterdrückt und abgewehrt werden, weil ansonsten die kognitive Dissonanz wieder deutlich zunehmen und nach einer Auflösung verlangen würde. Deshalb reagieren Suchtkranke am Anfang und manchmal auch über längere Zeit gereizt und aggressiv, wenn sie auf ihr Verhalten und negative Aspekte davon angesprochen werden.
(5)
Ich-Syntonie: Ich-Syntonie bedeutet, dass man sich in vollständigem Einklang mit sich selbst fühlt. Wenn diese Ich-Syntonie jedoch auf Verzerrungen, Fehlwahrnehmungen und Unterdrückung oder Fehlen kritischer Rückmeldungen basiert, wird sie zum Problem. Man ist mit sich im Einklang, ist dadurch von der Notwendigkeit einer Veränderung befreit und kann so bleiben, wie man ist, solange man an das stark unrealistische Selbstbild glaubt. Die Selbsttäuschung wird nicht mehr wahrgenommen, sondern ist fester Bestandteil der Identität und Persönlichkeit. Jeder Mensch praktiziert Selbsttäuschung. Sie dient dazu, das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen. Übersteigt die Selbsttäuschung das normale Maß, führt sie im Alltag jedoch zu vielen Fehlwahrnehmungen und sozialen Konflikten.
Wenn die Ich-Syntonie ganz oder überwiegend auf Fehlwahrnehmungen beruht, sind psychische und soziale Probleme vorprogrammiert. So nehmen sich Menschen mit Essstörungen oft als dicker und hässlicher wahr, als sie tatsächlich sind. Alle Versuche, sie vom Gegenteil zu überzeugen, scheitern, weil der Glaube an das eigene Dicksein eine hartnäckige Überzeugung und Teil der Identität. Substanzabhängige sind von ihrer Fähigkeit, ihren Konsum kontrollieren zu können, überzeugt, obwohl sie ihre Selbstkontrollfähigkeiten längst verloren haben.
Konkrete Formen des Selbstbetrugs
Es gibt zahlreiche konkrete Formen des Selbstbetrugs, die bei Sucht einzeln oder kombiniert auftreten können. Die wichtigsten sind im Folgenden dargelegt:
1. Leugnung
Leugnung ist die simpelste Form des Selbstbetrugs. Ein Problem wird vollkommen abgewehrt und damit verleugnet. „Ich habe kein Problem.“ Alle negativen Rückmeldungen sind nicht berechtigt. Meistens ein Hinweis, dass die Person sich in der Phase der Vorbesinnung (Pre-Contemplation) befindet.
Funktion: Schutz vor Scham, Schuld und Veränderungsdruck.
2. Bagatellisierung
Ein Problem wird grundsätzlich wahrgenommen, aber verniedlicht. „So schlimm ist es doch nicht. Andere trinken mehr.“ Durch den realen oder imaginierten Vergleich mit anderen kann das eigene Problem herabgestuft und als nicht relevant eingeschätzt werden. Solche sozialen Vergleiche – ob realistisch oder manipuliert – beruhigen das Ego, dass alles doch gar nicht so schlimm sein kann.
Funktion: Soziale Vergleiche mit anderen mildern und beruhigen das eigene Unbehagen.
3. Rationalisierung
„Ich brauche das halt zum Einschlafen, gegen den Stress, für meine Alltagsbewältigung usf.“
Der kontinuierliche Substanzkonsum ist für den Betroffenen zwar irgendwie nicht in Ordnung, gehört aber so sehr zum Alltag und zur Alltagsbewältigung, dass er in Kauf genommen wird. Ein verändertes Verhalten ist kaum vorstellbar. Man muss sich eine Legitimation für das problematische eigene Verhalten schaffen.
Funktion: Problematischer Substanzkonsum wird als notwendige und zweckmäßige Lösung verklärt. Die daraus entstehende Sucht wird in Kauf genommen.
4. Verschiebung der Verantwortung
„Wenn meine Frau mich nicht so nerven würde …“; „Wenn Sie so einen Chef hätten, würden Sie auch saufen“; „Ich hatte halt eine schlimme Kindheit“.
Die Verantwortung für das eigene Problemverhalten wird an anderen Personen oder äußeren Umständen festgemacht (Externalisierung). Damit stilisiert man sich ausschließlich als Opfer, muss keine Verantwortung übernehmen und kann sich auch nicht verändern.
Funktion: Die Kontrolle wird nach außen verlagert – das eigene Verhalten und das ganze Leben erscheinen fremdbestimmt. Man stellt sich als Opfer dar, das daraus nicht mehr entfliehen kann.
5. Intellektualisierung
„Ich habe mal gelesen, Alkohol in Maßen sei gesund.“ „Es gibt Drogen, die viel schlimmere Schäden machen als Kokain“.
Der Bezug auf vermeintliche oder echte Forschungsergebnisse soll von dem eigenen Problemverhalten ablenken und eine Legitimierung dafür schaffen. Dadurch werden entstehende problematische Gefühle rationalisiert und reduziert.
Funktion: Emotionale Themen werden auf eine sachliche Ebene gezogen, um innere Konflikte wegen des erlebten Kontrollverlustes zu vermeiden.
6. Verschiebung auf die Zukunft
„Ich werde bald damit aufhören“. „Ab morgen höre ich auf“. Die Aussage, dass man sich bald ändern wird, soll das Ich und das soziale Umfeld beruhigen, nutzt aber als echte Motivation wenig, da die Änderungsabsicht zu vage und schwach ist. Es handelt sich damit auch um eine Selbsttäuschung, da alles auf der verbalen, nicht handlungsrelevanten Ebene bleibt.
Funktion: Die verbale Ankündigung einer Änderung wirkt wie ein Versprechen, dient aber primär der Selbst- und Fremdberuhigung.
7. Pro und Kontra-Erleben, Ambivalenz
„Ich weiß, dass es nicht gut ist – aber es geht nicht anders.“ „Es geht mir ja nicht gut damit, dass ich so viel konsumiere, aber ich kann einfach nicht anders“.
Die für Suchtprobleme typische Ambivalenz zwischen Einsicht in das Problematische des Verhaltens und der gleichzeitigen Erkenntnis, dass man sich nicht ändern könne, schafft ein innerliches Patt, das über lange Zeit bestehen kann. Es entsteht ein stabiles Gleichgewicht aus Problemeinsicht und Änderungsvermeidung, das in der Regel nur durch externe Ereignisse (vgl. 8F der Fremdmotivation; Die 8F der Suchttherapie – Veränderung beginnt mit F!) erschüttert werden kann. Eine Änderung geschieht zunächst nur aus fremdmotivationalen Gründen („Wegen meiner Frau will ich nicht mehr trinken“; „Um meinen Job zu behalten, höre ich auf“).
Funktion: Zwei widersprüchliche Gedanken werden gleichzeitig aufrechterhalten – Problemeinsicht und Konsumbedürfnis. Der Betroffene akzeptiert sein Suchtverhalten als unveränderliches Faktum, als Teil seiner Person.
Therapeutische Perspektiven: Wege aus der Selbsttäuschung
Die Überwindung der selbsttäuschenden Kognitionen stellt bei der Behandlung von Suchtproblemen eine der wichtigsten Aufgaben dar. Sie haben sich oft schon zu einem chronischen Muster von Selbstbetrug verdichtet. Es braucht einen Durchbruch zur Realität.
Besonders wichtig ist die Suchtselbsthilfe, damit der einzelne Suchtkranke durch das Vorbild und die Offenheit genesener Suchtkranke Antrieb und Hoffnung erhält.
Psychotherapeutisch gesehen ist die Arbeit am Selbstbetrug ein Balanceakt: Einerseits muss die psychologisch schützende Funktion des Selbstbetrugs anerkannt werden – andererseits darf die Illusion nicht zur chronifizierten Lebenslüge werden. Methoden wie das Motivational Interviewing oder die kognitive Verhaltenstherapie setzen genau hier an: Sie respektieren Ambivalenzen, fördern aber schrittweise Einsicht.
Ambivalenzen verstehen, Diskrepanzen entwickeln, Empathie zeigen (Motivational Interviewing)
Das Verfahren des Motivational Interviewing (nach Miller & Rollnick) gilt heute als einer der wirksamsten Ansätze in der Suchttherapie. Es verzichtet auf Konfrontation, negative Bewertung und Verurteilung und setzt stattdessen bei der inneren Ambivalenz des Suchtkranken an. Der Patient wird eingeladen, sowohl die Vorteile als auch die Nachteile seines Konsums zu erkennen und für sich zu benennen. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen Selbstbild und Verhalten, die nicht vom Therapeuten aufgezwungen wird, sondern aus der Selbstreflexion erwächst. Typische Fragen sind: „Was gibt Ihnen der Konsum?“ – „Und was kostet er Sie?“ Der zentrale Gedanke: Veränderung wird dann möglich, wenn der Betroffene seine eigenen Gründe dafür entwickelt („Change Talk“) und diese als realistisch zu schätzen versteht.
Kognitive Verhaltenstherapie: Verzerrungen erkennen und prüfen
Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) nach A.T Beck will vorherrschende Denkfehler bewusst machen, die den Konsum stabilisieren: „Ich halte das ohne Alkohol nicht aus“; „Nur wenn ich konsumiere, bin ich entspannt“; „Ohne Drogen bin ich nichts wert“. Solche Sätze werden im sokratischen Dialog hinterfragt, in Gedankenprotokollen überprüft und mit Erfahrungen aus der Realität konfrontiert. So entsteht ein neues, realistischeres Denken, das weniger anfällig für Selbsttäuschung ist.
Wichtige therapeutische Prinzipien dabei sind:
- Empathisches Spiegeln: Konfrontation ohne Beschämung.
- Sokratischer Dialog: Fragen statt Urteilen.
- Selbstklärung: Förderung eines kohärenten, realitätsnahen Selbstbilds.
Ziel ist nicht die “nackte Wahrheit” um jeden Preis, sondern ein Selbstverhältnis, das tragfähig und entwicklungsfähig ist.
Narrative Arbeit: Die Geschichte der Lügen erzählen
In der Suchtselbsthilfe und Suchttherapie hat es sich bewährt, die eigene Konsumgeschichte zu erzählen – nicht nur die der Drogen, sondern auch die der „Lügen“. Wann begann der Betroffene, sich selbst etwas vorzumachen? Welche Geschichten halfen ihm, das Unangenehme zu verdecken? Die narrative Neubearbeitung erlaubt es, diese Schutzgeschichten als Teil der Suchtbiographie zu würdigen und gleichzeitig neue, ehrlichere Erzählungen zu entwickeln. Das Ich entwickelt damit eine konsistentere und tragfähigere Identität.
Selbstmitgefühl: Wahrheit ertragen, ohne zu zerbrechen
Eine Gefahr der Arbeit am Selbstbetrug liegt darin, dass der Patient in Selbsthass stürzt. Deshalb ist Selbstmitgefühl ein notwendiges Gegengewicht. Der Betroffene lernt, sich mit menschlicher Wärme zu begegnen, auch wenn er Schwächen erkennt. So kann er sich vertieft verstehen, aber auch vergeben. Nur so wird die Wahrheit tragbar: nicht als Vernichtungsurteil, sondern als Ausgangspunkt für Heilung. Übungen zur Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit helfen, den Schritt aus der Selbsttäuschung nicht als Strafe, sondern als Befreiung zu erleben.
Fazit
Selbstbetrug ist ein zentraler Bestandteil der Suchtpsychodynamik. Wer ihn erkennt, kann ihn nicht einfach durchbrechen – aber verstehen, entwirren und achtsam hinterfragen. Der Weg aus der Sucht führt nicht nur über Abstinenz – sondern über Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Die dauerhafte Genesung von der Sucht, der Recovery-Prozess, gelingt über Selbstreflektion, Selbsterkenntnis und Wahrhaftigkeit. Wir dürfen vor unserer innersten Wahrheit nicht erschrecken und brauchen es auch nicht, wenn wir Geborgenheit finden wollen. Sozial, mit uns selbst, spirituell und transzendent.
Schlusssatz zum Nachdenken
Selbstbetrug schützt mich vor dem Schmerz – aber Ehrlichkeit öffnet mir die Tür zur Veränderung.