Inhaltsübersicht
Zur Entstehung der Sucht gehören viele Ursachen
Psychische Störungen sind multikausal determiniert. Zur Erklärung der Entstehung, auch von Suchterkrankungen, wird das biopsychosoziale Modell herangezogen. Demnach sind biologische, psychologische und soziale Faktoren an der Entstehung von Sucht in je nach Individuum unterschiedlich starken Anteilen beteiligt. Eine Suchterkrankung ist also multikonditional verursacht. In der Frühphase der Suchtentstehung spielen meist die sozialen Faktoren eine besonders starke Rolle: ungünstiges Modellverhalten der Eltern, Konsumdruck durch Freunde, soziale Randständigkeit in Schule und Freizeit. Zunehmend werden dann psychologische Merkmale wichtig: negatives Selbstbild, negative selbstbezogene Kognitionen, Ängste, depressive Verstimmungen, Kompetenzmangel in Interaktionen, problematische Persönlichkeitsmerkmale in den Bereichen Impulsivität, Narzissmus, emotionale Instabilität, Antisozialität, Dependenz und Selbstunsicherheit. Wird erst einmal konsumiert oder exzessives Verhalten (etwa Glücksspiel, Medienkonsum) ausgeführt, greifen auch die biologischen Risiken: Gewöhnung des Gehirnstoffwechsels an die Konsumwirkungen, Veränderung der neurobiologischen Strukturen des Gehirns, Entwicklung von Toleranz und Entzugserscheinungen.
Sucht ist mehr psychologisches Geschehen, als gemeinhin bekannt
Die Psychologie sieht süchtiges Verhalten als in großen Teilen gelernt. Deshalb ist die Berücksichtigung der Biographie als Lerngeschichte im Rahmen eines umfassenden biopsychosozialen Modells unerlässlich. Dabei spielen alle bekannten Formen des psychologischen Lernens eine Rolle:
(1) Klassisches Konditionieren (Signallernen): Suchtkranke reagieren auf den Anblick, die Geräusche und den Geruch alkohol- und drogenassoziierter Reize und die Substanzen selbst.
(2) Instrumentelles Konditionieren (Lernen am Erfolg): Suchtkranken werden durch die kurzfristigen Konsequenzen des Substanzkonsums in ihrem Verhalten gesteuert. Nachlassende Angst, Abnahme des Stressgefühls, Steigerung des Selbstwertgefühls und Zunahme der Geselligkeit sind nur einige Beispiel der konditionierbaren Effekte des Substanzkonsums.
(3) Modelllernen (auch Imitationslernen genannt): Menschen, besonders Kinder und Jugendliche, lernen das, was ihnen gezeigt und vorgelebt wird. Trinkende Väter oder Mütter, konsumierende Peers, intoxikierte Promis sind die wichtigsten Beispiele. Man kann nicht nicht Modelllernen. Aber Suchtkranke können auch von anderen Suchtkranken in der Selbsthilfe oder von Beratern und Therapeuten lernen.
(4) Erwartungslernen (Kognitives Lernen): Mit dem Konsum von Substanzen werden Erwartungen an deren künftige Wirkung gelernt und das Erlernte festigt sich mit jedem Konsum weiter. So entstehen irrationale Wirkungserwartungen. Ich kann nur mit meinem Chef reden, wenn ich etwas getrunken habe; ich kann nur Sex haben unter Drogen; diese Welt ist nur mit Drogen zu ertragen; um mich zu entspannen, brauche ich unbedingt Alkohol, sonst geht das nicht. Diese Sätze, die implizit gelernt werden und dann zum automatischen, unbewussten Denken gehören, sind nur einige Beispiele zur Verdeutlichung des Prinzips. Sie können auch neuerliches Verlangen und Rückfälle auslösen, vor allem wenn sie mit Signalen (siehe Punkt 1) gekoppelt werden.
Mehrere Lernwege führen in die Sucht
Auf diesen verschiedenen lernpsychologischen Wegen können Verknüpfungen zwischen Substanzkonsum, Motiven zum Konsum, kurz- und langfristigen Konsumfolgen entstehen. In der Therapie der Sucht werden die verfestigten Suchtverhaltensweisen mit therapeutischen Methoden modifiziert. Substanzsüchte ebenso wie Verhaltenssüchte sind von ihrer Funktionalität her zu betrachten. Dies betrifft die meist unbewussten Motive und subjektiven Nutzenaspekte des Konsums, die von den Betroffenen meist lange Zeit nicht wahrgenommen, kognitiv verzerrt verarbeitet oder völlig ausgeblendet werden (siehe ausführlich: „Sucht als Wahrnehmungs- und Denkstörung: Kognitive Abwehr und Verzerrungen bei Suchtstörungen“).
Meist stehen hinter exzessivem Konsum Motive in den Bereichen Selbstmedikation, Stressreduktion, Geselligkeitssteigerung und Eskapismus. Eskapismus bezeichnet dabei die Tendenz zur Flucht aus der Realität oder zur Vermeidung wichtiger anstehender Aufgaben und Verpflichtungen. Frühe lebensgeschichtliche Erfahrungen von Modelllernen des elterlichen Verhaltens bis hin zu kindlichen Traumatisierungen können Suchtentwicklungen ab dem Jugendalter wahrscheinlicher machen. Gerade früher Substanzkonsum ist im Kontext von Familie und Peer-Gruppe zu betrachten. Oft entwickeln die späteren Suchtkranken schon als Kinder Symptome von Ich-Schwäche, überschießender Aggressivität oder Ängstlichkeit und werden wegen ihrer Auffälligkeiten von anderen Kindern gemieden.
Das hilfreiche Profil eines psychologischen Suchthelfers
Die psychotherapeutische Behandlung von Sucht basiert auf verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologischen Erkenntnissen und Methoden, die bei frühzeitiger und oft auch längerfristiger Anwendung Erfolge bringen, wie die empirische Suchttherapieforschung zeigt. Im Folgenden sind stichwortartig die bei den Helfern (Therapeuten, Berater) notwendigen psychologischen Kompetenz aufgelistet.
Haltung:
Akzeptanz, Empathie, Respekt, Allparteilichkeit, Wertschätzung, Ressourcenorientierung, Überzeugung, dass Veränderung möglich ist, Begegnung auf Augenhöhe, Offenheit, Flexibilität, vorsichtiger Optimismus, Kooperativität mit anderen Fachkräften, Interdisziplinarität.
Wissen:
Ätiologie-, Bedingungs- und Veränderungswissen, Suchtwissen biopsychosozial, Funktionalität von Suchtmitteln, Psychopharmakologie, Therapiemethoden und –prozesse, Leitlinien und Evidenzen zu Suchttherapie, psychische Komorbiditäten, Rückfallprävention und –intervention, Kenntnisse zu Versorgungssystemen, Sozialrecht, Angehörigensituation und Nachsorgeangeboten.
Methoden:
Psychotherapiemethoden: Verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch, systemisch, personenzentriert. Außerdem: Rückfallbearbeitung, Angehörigenarbeit. Multimodale Suchttherapie, Komorbiditätstherapie, Netzwerkarbeit.
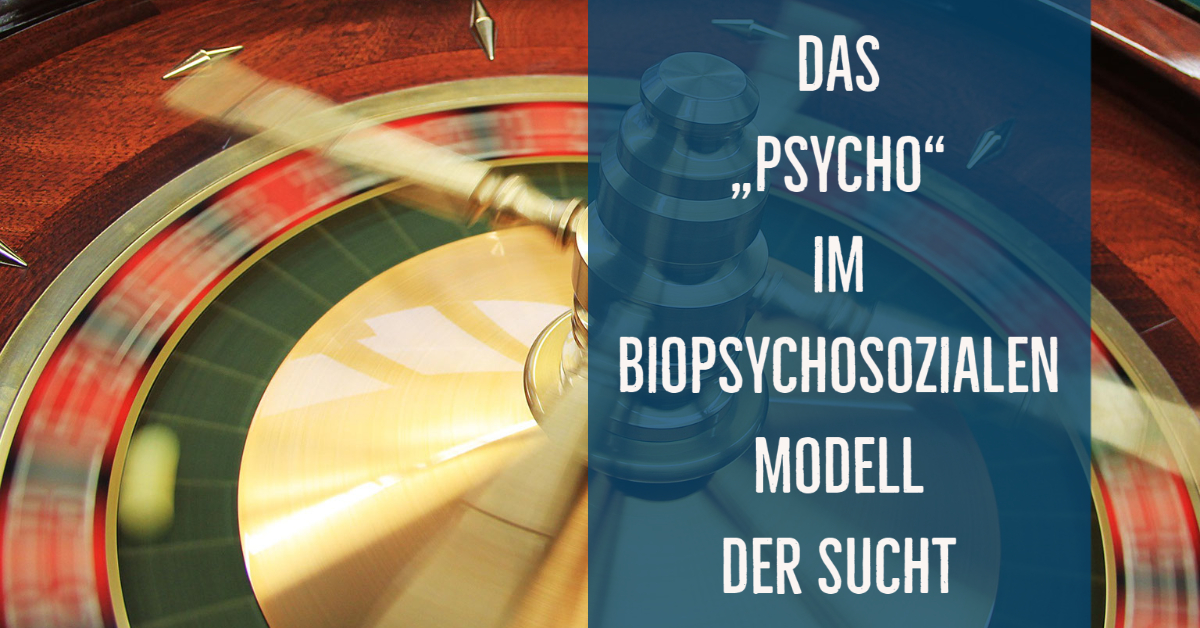
2 thoughts on “Das „Psycho“ im biopsychosozialen Modell der Sucht – die psychologischen Zugänge zur Entstehung und Behandlung”