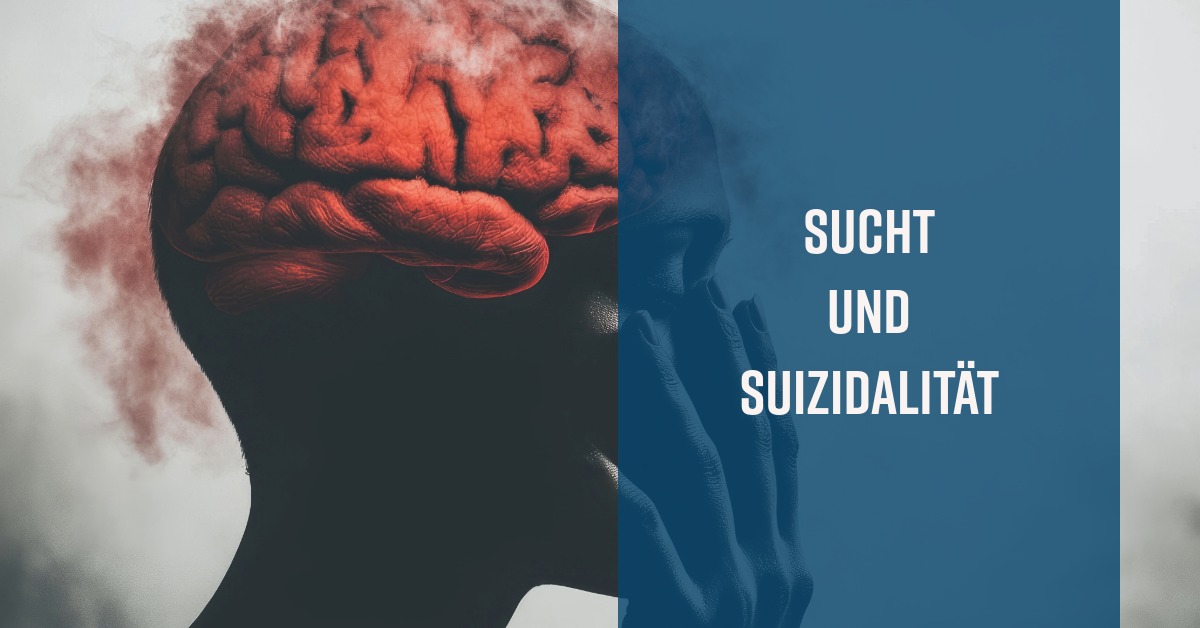Fachtext zur Schnittstelle zwischen substanzbezogenen Störungen und suizidalem VerhaltenDisclaimer: Wenn Sie als Betroffener in einer suizidalen Krise sind, holen Sie sich zunächst Hilfe bei Ihrer örtlichen Suchtberatungsstelle oder der Telefonseelsorge (0800-1110111 bzw. 0800-1110222)
Inhaltsübersicht
1. Einleitung
Sucht und Suizidalität hängen im Leben von Betroffenen häufiger zusammen, als dies vielen Fachkräften bewusst ist. In Krisensituationen der Sucht (Verlangen, Rückfall, Entzug) kann sich latente Suizidalität zur Suizidhandlung ausweiten, oft unter Einfluss von Substanzen. Menschen mit substanzbezogenen Störungen zeigen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein signifikant erhöhtes Risiko für suizidale Gedanken, Suizidversuche und vollendete Suizide. Die Komorbidität mit affektiven Störungen, soziale Destabilisierung und Marginalisierung durch Abhängigkeit sowie neurobiologische und psychodynamische Faktoren tragen wesentlich zu dieser erhöhten Vulnerabilität bei. Der Psychiater Karl Schuhmacher wies schon früh darauf hin, dass die „Selbstzerstörung über den Körper“ für viele schwerabhängige Menschen eine lebenslange Realität darstellt – häufig begleitet von Schuld, Scham und innerer Vereinsamung.
Der vorliegende Beitrag beleuchtet epidemiologische Daten, Risikofaktoren, ätiologische Konzepte, psychodynamische Hintergründe sowie präventive und therapeutische Ansätze anhand aktueller Literatur und Fallbeispiele.
2. Epidemiologische Daten
Das Suizidrisiko bei Menschen mit Suchterkrankungen ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um bis zum 20-fachen erhöht (Udo Schneider, 2020). Die Lebenszeitprävalenz für Suizidversuche bei Alkoholabhängigen liegt zwischen 20 und 30 %, bei Opiatabhängigen sogar noch höher. Etwa 15–20 % der Alkoholkranken versterben im Verlauf ihres Lebens durch Suizid. Damit ist die Alkoholabhängigkeit nach affektiven Störungen die psychische Störung mit dem zweithöchsten Suizidrisiko. Bei polytoxikomanem Substanzgebrauch steigen Risiko, Letalität und Chronifizierung zusätzlich an (WHO, 2014). Suchtprävention ist insofern auch ein wichtiger Bereich von Suizidprävention – und umgekehrt.
3. Risikofaktoren im Kontext der Suchterkrankung – Hintergründe
Die Erhöhung des Suizidrisikos bei Suchtkranken ist multifaktoriell bedingt. Zentral dafür sind folgende Einflussfaktoren:
- Das Vorliegen komorbider psychischer Störungen, vor allem Depressionen, bisweilen auch Psychosen, Angststörungen, Traumafolgestörungen und Persönlichkeitsstörungen.
- Suizidale Impulse bei Suchtkranken stehen häufig in Zusammenhang mit langjähriger Traumatisierung in der Kindheit, insbesondere bei Frauen. Frühe Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen können sich später in Sucht- und suizidalen Mustern verfestigen.
- Viele betroffene Suchtkranke zeigen im Umfeld von Suizidalität eine erhöhte Impulsivität und Affektlabilität, die suizidale Handlungen begünstigen kann.
- Soziale Isolation, chronische Einsamkeitsprobleme, Konflikte in der Partnerschaft sowie Arbeitslosigkeit verstärken die psychosoziale Belastung.
- Langfristiger exzessiver Substanzgebrauch führt zu neurotoxischen Veränderungen, die emotionale Regulation und Impulskontrolle beeinträchtigen.
- Hoffnungslosigkeit, ein Gefühl der Perspektivlosigkeit und narzisstische Kränkungen sind häufige emotionale Auslöser suizidaler Krisen.
Darüber hinaus fungiert der Substanzkonsum häufig selbst als Mittel zur Affektregulation – mit suizidvermeidender oder -auslösender Wirkung. Alkohol wirkt beispielsweise enthemmend und kann eine suizidale Handlung wahrscheinlicher machen (Bryan & Rudd, 2025).
4. Fallvignette I: Sucht und Suizidalität
Udo K., 46 Jahre alt und seit 15 Jahren alkoholabhängig und seit 10 Jahren abstinent, wurde aufgrund eines Alkoholrückfalls mit suizidalen Gedanken in einer psychiatrischen Entzugseinrichtung eingewiesen. Er war über Jahre hinweg als Berufskraftfahrer tätig gewesen, entwickelte eine Alkoholabhängigkeit nach einer für ihn sehr schmerzhaften Trennung und verlor später dadurch seine Arbeitsstelle. In der Vergangenheit hatte er bereits einmal kurz nach der Trennung seiner Partnerin einen Suizidversuch unternommen. Durch eine gezielte sozialpsychiatrische Betreuung war seine akute Krisensituation frühzeitig erkannt worden. Ab diesem Zeitpunkt erhielt er eine engmaschige psychiatrische und suchttherapeutische Betreuung.
Im Rahmen dieses integrativen Behandlungsansatzes, der Suchttherapie, Krisenintervention und psychotherapeutische Einzelgespräche umfasste, konnte Udo K. wieder schrittweise Stabilität aufbauen. Besonders hilfreich waren für ihn ein Männer-Selbsthilfeangebot sowie der Zugang zu betreutem Wohnen. Nach sechs Monaten war er abstinent, arbeitete stundenweise wieder in einem Lager und berichtete, dass er durch die Abstinenz und die Arbeit „zum ersten Mal seit langem wieder einen Sinn im Leben“ verspüre.
5. Psychodynamik suizidaler Krisen bei Sucht
Aus psychodynamischer Sicht ist die suizidale Handlung bei Suchtkranken häufig Ausdruck einer tiefen Ambivalenz zwischen Selbstbestrafung, Erlösungsstreben, aggressiver Impulsabfuhr und dem diffusen Wunsch nach Veränderung. Udo Schneider (2020) spricht von einem „Weg zwischen Sterben und Überleben (Udo Schneider, 2020)“, bei dem der Substanzgebrauch selbst Teil des suizidalen Modus ist: entweder als Weg in die Selbstauflösung oder als „Suizid auf Raten“. Viele suchtkranke Menschen erleben in suizidalen Krisen ein Gefühl völliger innerer Leere, gepaart mit dem Verlust jeglichen Zugehörigkeitsgefühls. Substanzkonsum dient dann oftmals als existenzielles Gegenmittel gegen diese innere Auflösungserfahrungen.
Im suizidalen Zustand ist die Fähigkeit zur symbolischen Verarbeitung von akuten und biographischen Erlebnissen reduziert. Gefühle wie Schuld, Scham, Versagen oder Verlassenheit erleben viele Betroffene als überwältigend und alternativlos. Der einzelne fokussiert sich immer mehr auf den Suizid, wobei sich seine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung in Bezug auf die Realität immer mehr einengen.
6. Ätiologie: Wie entsteht Suizidalität bei Suchtkranken?
Die Entstehung von Suizidalität im Kontext von Suchtstörungen ist mehrdimensional. Auf neurobiologischer Ebene beeinflussen Substanzen wie Alkohol, Opiate und Kokain die Funktion des Serotonin- und Dopaminsystems, was Impulsivität, Affektlabilität und depressive Zustände fördern kann. Gleichzeitig werden die kognitive Verarbeitung der Realität und das Gedächtnis gestört. Psychodynamisch spielen ungelöste frühe Traumata, Bindungsstörungen und internalisierte Schuld- und Schamgefühle eine zentrale Rolle.
Auf sozialer Ebene wirken chronische Belastungen, Armut, Wohnungslosigkeit, Stigmatisierung und fehlende soziale Unterstützung als Verstärker eines ohnehin erhöhten Grundrisikos. Suchtmittel werden häufig zur Selbstmedikation eingesetzt – ein dysfunktionaler Versuch, emotionale Spannungen zu regulieren. Die Grenze zwischen dysfunktionalem Coping und suizidalem Erleben (Rudd, 2006) ist dabei oft fließend. Suchtkranke befinden sich häufig in einem Teufelskreis aus Absturz, Selbstabwertung, Rückzug und Selbstaufgabe.
7. Prävention und Psychotherapie – Lösungen und Hilfen
Die Prävention von Suizidalität bei Suchtkranken ist ein zentraler Bestandteil therapeutischer und psychosozialer Versorgung. Sie setzt an drei Ebenen an:
1. Primärprävention: Frühe Aufklärung über Suchtrisiken, Förderung emotionaler Bildung, Stärkung psychischer Schutzfaktoren (Resilienz, Selbstwirksamkeit).
2. Sekundärprävention: Früherkennung von Suizidalität im Kontakt mit Suchthilfe, Hausarzt oder psychiatrischen Diensten – Screeninginstrumente wie C-SSRS oder BSI sind hier hilfreich.
3. Tertiärprävention: Rückfallprophylaxe und Rückfallintervention, therapeutische Aufarbeitung von Krisen, Stärkung des Lebenssinns und der sozialen Integration. Schnelle Hilfen bei Rückfall.
Hinzu kommen im Sinne der selektiven Prävention (Prävention für Risikogruppen) Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren Eltern suchtkrank waren und/oder einen Suizid begangen haben. Sie sind besonders gefährdet, dies wieder zu erleben.
Psychotherapeutisch bewährt haben sich integrative Ansätze, etwa die Kombination aus verhaltenstherapeutischen, tiefenpsychologischen und existenzanalytischen, logotherapeutischen Methoden. Ziel ist es, sowohl sucht- als auch suizidrelevante Themen zu bearbeiten: Umgang mit Scham, Selbstabwertung, chronischer Einsamkeit und Schuld, Herausarbeitung eines Lebenssinns und soziale Re-Integration. Eine haltgebende therapeutische Beziehung, klare Strukturen, Rückfallmanagement und biografische Integrationsarbeit bilden die Grundlage einer langfristigen Stabilisierung.
8. Geschlechtsspezifische Perspektiven
Schneider & Wetterling (2016) betonen die Notwendigkeit gender- und traumasensibler Interventionen. Insbesondere suchtkranke Frauen mit Gewalterfahrung benötigen Schutzräume und therapeutische Angebote, die auf Sicherheit und Selbstwirksamkeit ausgerichtet sind.
Männer mit Suchterkrankungen zeigen ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko, was sowohl mit biologischen als auch mit psychosozialen Faktoren zusammenhängt. Studien zur Suizidologie erbrachten, dass Männer häufiger „harte Methoden“ bei Suiziden wählen, seltener psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und ihre Krisen weniger kommunizieren. Traditionelle Männlichkeitsnormen wie Autonomie, Kontrolle und Unverletzlichkeit, aber auch Scham- und Schuldgefühle erschweren eine frühe Wahrnehmung von Hilfen und allgemein mehr Offenheit gegenüber Interventionsangeboten.
Zugleich zeigen neuere Forschungsansätze, wie etwa vom Centre for Male Psychology (UK), dass geschlechtersensible Interventionen – etwa männliche Ansprechpartner, lösungsorientierte Kurzzeitformate und strukturgebende Gruppenangebote – positive Effekte auf die Inanspruchnahme und Stabilisierung haben können. Eine erfolgreiche Suizidprävention muss daher auch an Männerbildern ansetzen und neue Optionen schaffen, in denen emotionale Offenheit nicht als Schwäche (Centre for Male Psychology, 2021) gedeutet wird.
9. Wohnungs- und Obdachlosigkeit
Wohnungs- und Obdachlosigkeit gelten als eigenständige Risikofaktoren für Suizidalität – insbesondere bei Männern mit Suchtstörungen und psychischen Erkrankungen. Betroffene erleben häufig chronischen Stress, soziale Ausgrenzung, Unsicherheit und existenzielle Not. Hinzu kommen mangelnder Zugang zu medizinischer Versorgung, Stigmatisierung und institutionelle Barrieren. Es entwickelt sich oft eine Spirale nach unten, die immer schwerer zu durchbrechen ist. Mehr als zwei Drittel aller chronisch wohnungslosen Menschen sind auch suchtkrank, meist alkoholabhängig. Gezielte, niedrigschwellige und aufsuchende Hilfen, auch im Sinne der Suizidprävention, sind für sie besonders wichtig.
Laut WHO (2014) ist bei obdachlosen Menschen das Risiko für Suizidversuche bis zu zehnmal höher (WHO, 2014) als in der Allgemeinbevölkerung. Die Sucht wird dabei häufig als Mittel zur Betäubung emotionaler oder körperlicher Schmerzen eingesetzt – mit hoher suizidaler Implikation. Suizidprävention in diesem Kontext erfordert aufsuchende Sozialarbeit, niedrigschwellige Angebote und systemübergreifende Koordination.
10. Versorgungslage und systemische Herausforderungen
Schneider & Wetterling (2016) kritisieren die fehlende institutionelle Verankerung suizidpräventiver Kompetenzen in suchtmedizinischen Einrichtungen und fordern verbindliche Fortbildungen für alle Fachkräfte mit direktem Patientenkontakt.
Die Versorgung suizidgefährdeter Suchtkranker leidet häufig unter strukturellen Defiziten. Dazu zählen:
Die Hilfesysteme für Suchtkranke einerseits, sozialpsychiatrische Angebote andererseits sind häufig unzureichend miteinander vernetzt.
In der Suchthilfe fehlt es oftmals an speziell geschultem Personal für suizidale Kriseninterventionen.
Ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote sind nicht ausreichend miteinander verzahnt und übermäßig versäult.
Die Erreichbarkeit von Krisendiensten unterscheidet sich regional erheblich und stellt insbesondere im ländlichen Raum ein Problem dar.
Insbesondere in ländlichen Regionen oder bei multipel belasteten Personen (z. B. wohnungslose Menschen mit Psychose und Sucht) stoßen bestehende Systeme schnell an ihre Grenzen. Notwendig ist ein Ausbau interprofessioneller Kriseninterventionsteams, eine verbesserte Finanzierung integrierter Versorgungsmodelle und ein konsequentes, nachgehendes Fallmanagement, das Versorgung kontinuierlich sicherstellt. Auch digitale Dienste können hierbei wichtige Aufgaben sicherstellen, ohne die Budgets stark zu belasten.
11. Fallvignette II: Sucht und Suizidalität
Robert S., 58 Jahre, wurde nach einem Suizidversuch (Erhängen im Keller), der nur durch das zufällige Eingreifen eines Nachbarn beendet wurde, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Vorgeschichte umfasst eine chronische Alkoholabhängigkeit, depressive Episoden und dauerhafte soziale Isolation nach einer Scheidung vor 8 Jahren. In der Anamnese zeigt sich eine familiäre Belastung mit Suizid (Großvater und Onkel), ein nicht betrauerter früher Verlust des Bruders (Unfall) sowie der Rückzug aus sozialen Kontakten bzw. das Fehlen solcher Kontakte. Erst im therapeutischen Setting kann Herr S. über Schuld- und Schamgefühle sprechen. Sein Suizid erschien ihm in den Wochen zuvor immer stärker als „letzter Ausweg“. Schließlich konnte er an nichts anderes mehr denken und wünschte sich immer mehr, sein Leben zu beenden. Die Kombination aus Biografie, Depression, Sucht und Einsamkeit machte ihn suizidal hochgradig gefährdet, ohne dass es jemandem aufgefallen war.
12. Fazit
Suizidalität bei Suchtkranken ist kein Randphänomen, sondern ein zentrales Thema in der Versorgung der betroffenen Menschen. Eine erfolgreiche Prävention muss über Standardinterventionen (Entzug, Anamnese) hinausgehen und die komplexe Lebenssituation, die emotionale Struktur und die biografischen Brüche der Betroffenen einbeziehen und proaktiv nach Suizidalität fragen. Die Kombination aus Empathie, Strukturgebung, vertrauensvoller therapeutischer Beziehung und existenzieller Ressourcenarbeit ist der Schlüssel zu einer langfristigen Stabilisierung und Reduktion des Suizidrisikos. Parallel dazu sollte die Suchtproblem bearbeitet werden.
13. Literatur
Beautrais, A. L. (2000). Risk factors for suicide and attempted suicide among young people. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34(3), 420–436.
Bryan, C. J., & Rudd, M. D. (2025). Suicide Risk Assessment and Intervention. New York: Guilford Press.
Caine, E. D. (2013). Forging an agenda for suicide prevention in the United States. American Journal of Public Health, 103(5), 822–829.
CCSA – Canadian Centre on Substance Use and Addiction (2024). Intersections of Substance Use and Suicide: Evidence and Key Takeaways.
Centre for Male Psychology (2021). Male Psychology and Suicide. London: CMP Press.
Galanter, M. (2023). Textbook of Substance Abuse Treatment (6th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Jordan, A. M., et al. (2022). Surging Racial Disparities in the U.S. Overdose Crisis. American Journal of Psychiatry, 179(3), 211–220.
Keyes, K. M., et al. (2023). Substance Use and Suicide Across the Life Course. Injury Epidemiology, 10(1), 21.
Larimer, M. E., et al. (2020). Mindfulness and substance use relapse prevention. JAMA Psychiatry, 77(9), 939–947.
Lembke, A. (2021). Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence. New York: Dutton.
Rudd, M. D. (2006). Fluid Vulnerability Theory of Suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 36(2), 117–128.
Schneider, B. & Wetterling, T. (2016). Sucht und Suizidalität. Stuttgart: Kohlhammer.
Schneider, U. (2020). Sucht und Suizid. Stuttgart: Kohlhammer.
Schuhmacher, K. (1998). Selbstzerstörung über den Körper. In: Psychiatrie heute, 18(4), 215–223.
Teismann, T., & Dorrmann, I. (2021). Suizidprävention. Göttingen: Hogrefe.
Tucker, J. A. (2001). Changing Addictive Behavior: Bridging Clinical and Public Health Strategies. New York: Guilford Press.
World Health Organization (2014). Preventing suicide: A global imperative. Geneva: WHO Press.